Häufige Fragen / Antworten
Videobeitrag: «Michael Seefried erzählt..»
Burnout
Den Puls des eigenen Herzens fühlen.
Ruhe im Inneren, Ruhe im Äusseren.
Wieder Atem holen lernen. Das ist es.Christian Morgenstern
Burnout oder eine ausgeprägte Erschöpfungssymptomatik ist eine ernstzunehmende Zäsur in jeder Biographie.
Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Das Auftreten eines Burnouts scheint unabhängig von der Intensität der Arbeitsbelastung zu sein.
Die Menschen mit Burnout berichten, ausgebrannt, leer und energielos zu sein; zuvor haben sie eine Periode der Atemlosigkeit, des «Hinterherrennens» erlebt.
Bleierne Müdigkeit trotz ausreichendem Schlaf, Erschöpfung, Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, Rückzugverhalten sind typische Symptome und von Depression oder ähnlichen Erkrankungen abzugrenzen.
Das Burnout wurde 1974 erstmalig vom amerikanischen Psychotherapeuten Herbert Freudenberger beschrieben. Es ist keine definierte Erkrankung wie Depression oder Angststörung, mehr ein Symptomenkomplex! Circa ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung weist Symptome eines Burnouts auf. Wird das Vollbild der Erkrankung erreicht, sind die Menschen monatelang nicht arbeitsfähig. Ein stationärer Aufenthalt verkürzt diese Rekonvaleszenzzeit eigentlich nicht, jedoch eine fachliche Begleitung, die die unten beschriebenen Themen mit dem Patienten therapeutisch aufarbeitet. In dieser Rekonvaleszenzzeit sollte der Betroffene neben der therapeutischen Begleitung aktiv Dinge tun, die ihm guttun: Ob das Sport, Spaziergänge oder auch handwerkliche Tätigkeiten sind, mag individuell unterschiedlich sein.
Neben der immensen Zunahme an Burnout-Erkrankten nehmen ebenso Herzkreislaufkrankheiten zu. Herzinfarkt und Schlaganfall sind die Nr. 1 in der Häufigkeit akut bedrohlicher oder tödlicher Erkrankungen in den Industrienationen.
Warum ist das so?
Wir sind körperliche, seelische und geistige Wesen. Die körperliche Ebene weist als Qualität unser Handeln auf, die geistige unser Denken und die seelische Ebene unser Fühlen. Zudem ist die seelische Ebene auch Vermittler zwischen dem unteren (Handeln) und oberen Menschen (Denken). Unser Lebensalltag in den Industrienationen betont Handeln und Denken und vernachlässigt sehr unser Gefühl. Das bedeutet, dass der Mensch insbesondere in diesem mittleren Bereich anfälliger wird für Erkrankungen.
Als Auftrag haben wir demnach, unser Leben so zu gestalten, dass unser mittlerer Mensch (Herzkreislaufsystem, Gefühl) gesunden und sich stabilisieren kann. Das zeigt auch das Burnout.
Warum ist ein Teil der Menschen empfänglich, ein Burnout zu entwickeln, und ein anderer eher nicht – unabhängig von der Arbeitsbelastung?
Abgrenzung: Ein wichtiger Punkt ist sicher, inwieweit ich gelernt habe, meine Grenzen zu ziehen – und zwar nicht nur im beruflichen Zusammenhang, sondern insgesamt.
Bin ich sehr akkurat, gewissenhaft und will alles sehr genau erledigen?
Setze ich mich dabei oft unter Stress?
Spüre ich da eine gewisse Unfreiheit? Also muss ich mein Ziel in verbissener Weise erreichen, auch wenn ich ganz genau merke, dass mir das nicht guttut? Habe ich schon einmal erfahren, dass ich dasselbe mit einer gewissen Leichtigkeit ohne diesen Stress ebenso erreichen kann?
Arbeitspensum: In der Regel haben Menschen mit Burnout ein hohes Arbeitspensum. Dies ist aber nicht Ursache des Burnouts – es ist vielmehr der Umgang und meine Haltung gegenüber der hohen Arbeitsbelastung. So kann das hohe Arbeitspensum ein Burnout triggern, verursacht es aber nicht.
Lebe ich mein Potenzial?
Gelingt es mir ganz bei mir zu sein, insbesondere wenn besonders belastende Ereignisse oder Momente auftreten? Gelingt es mir auch im grössten Sturm, innerlich ruhig zu bleiben? Karl Grunick beschreibt dies als Grundtonus (siehe Karl Grunick, «Entdecke deine Körperintelligenz»).
Bin ich noch verletzbar? Gibt es noch Bereiche, in denen ich verletzbar bin? Lasse ich mich unter bestimmten Umständen schnell ärgern und aus dem Konzept bringen? Bin ich rasch gekränkt?
Kränkungen:
«Mich kann niemand beleidigen, wenn ich es nicht zulasse.»
Wer kennt nicht das Gefühl der Kränkung?
Eine Kränkung ist immer ein Ereignis auf der Ebene einer Ich–Du–Beziehung. Mein Hund oder mein Kind beispielsweise können mich nicht kränken, denn die Ich–Du–Beziehung ist nicht auf Augenhöhe.
Kränkung ist meine Sache!
Mein Gegenüber ist in der Regel nicht dafür verantwortlich, dass ich sein Handeln als Kränkung empfinde. Die Kränkung, die sich bei mir einstellt, hat mit mir zu tun, mit meinen Erfahrungen, meiner Biographie, meinen Hürden oder Verstrickungen, die mir aufzeigen, wo ich noch verletzbar bin (siehe entsprechenden Artikel auf www.paracelsus-zentrum.ch).
Wo ich noch verletzbar bin, bin ich noch nicht erwachsen geworden. Es lohnt sich, die Ursachen genauer zu beleuchten.
Nun kann ich das Gesagte auf unser Thema Burnout übertragen.
Burnout kann entstehen, wenn meine Haltung, meine Gefühle und meine Handlungen von mir überkontrolliert werden, ich ständig hinterherlaufe, das Vorgenommene nicht schaffe und gleichzeitig wieder meine Grenzen nicht beachtet habe. «Ich hatte mir doch vorgenommen, wirklich um 18 Uhr Schluss zu machen» … und schon befinde ich mich in einem Teufelskreis.
Erwartungen:
Das ist ein grosses Thema: Denn wie uns die letzten drei Jahre sehr eindrücklich gezeigt haben, ist das Leben nicht vorhersehbar, und es kann in jedem Moment solche Überraschungen geben, die mein gesamtes Leben auf den Kopf stellen.
Fragen wir uns: Wo habe ich in meinem Leben zu viele Erwartungen oder solche Erwartungen, die mich unfrei machen und stressen? In der Partnerschaft, bei meinen Kindern, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei Lehrpersonen auch die Schülerinnen und Schüler, meinen Zielen, meiner Lebensgestaltung …? Oder gelingt es mir, meine Erwartungen zurückzustellen und neugierig zu sein, was da kommen mag?
Verschliessen wir uns vor dem Leben?
Wenn wir erwarten, machen wir uns eng. Wir fordern etwas heraus, wie es zu sein oder sich zu entwickeln hat. Dadurch, dass wir nur auf das zu erwartende Ziel fokussiert sind, verschliessen wir die Augen vor anderen Möglichkeiten, die sich in der Zwischenzeit durch die Ereignisse des Lebens ergeben können; wir verschliessen uns letztendlich vor dem Leben.
Haltung: Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass ich bei meiner Arbeit auch im Umgang mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schülerinnen und Schülern von meinem Gegenüber nichts (mehr) erwarte, sondern es ganz annehmen kann, was mir da entgegenkommt, und versuche, es innerlich nicht zu bewerten, sondern als Geste oder Botschaft anzunehmen.
Das kann dazu beitragen, dass ich innerlich entspannter, ruhiger und mehr bei mir selbst bleibe. Das wäre auch ein erster Schritt in Richtung des nächsten Kapitels.
Die Neugestaltung sozialer Beziehungen: seit Corona sehr beschleunigt
Mit grosser Wucht sind wir mitten im sogenannten Wassermann-Zeitalter gelandet (siehe Artikel «Ist die Welt im Chaos?» www.paracelsus-zentrum.ch). Lange haben sich das Ende des Fische-Zeitalters und der Beginn des Wassermann-Zeitalters als wichtige Meilensteine in der Menschheitsentwicklung angebahnt. Rudolf Steiner hat von «Bewusstseinsseelen-Zeitalter» gesprochen; letztendlich ist dasselbe gemeint, auch wenn die Zeitangaben um ein paar Jahrhunderte differieren. Entscheidend ist meiner Meinung nach der Entwicklungsprozess.
Im Fische-Zeitalter lernte die Menschheit, in Polaritäten zu denken, zu fühlen und zu handeln. Dies sollten wir verinnerlicht haben. Religionen mit Dogmen und den 10 Geboten konnten bei diesem Prozess in der Vergangenheit eine Hilfestellung sein. Nun – im Wassermann-Zeitalter – sollten wir genau diese Qualitäten überwinden lernen. Jetzt haben wir den Auftrag, individuelle und globale Verantwortung zu übernehmen, den Egoismus zu überwinden sowie Gutes und Verantwortbares für unsere Erde zu tun. Dogmen und «Du musst» sind nicht mehr zeitgemäss. Diese Werte sollen nun in jedem von uns enzwickelt sein und leben.
Dazu gehört in der Konsequenz die Neugestaltung sozialer Beziehungen. Aus meiner Sicht ist dies ein Kernthema auch für die Entstehung bzw. Verhütung von Burnout und hilft uns in der individuellen Bewusstseinsentwicklung.
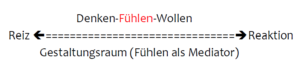
Anregungen für Lehrpersonen, Eltern und Kinder/Jugendliche
Wir leben in einer besonderen Zeit, die Besonderes von uns verlangt. Viele Dinge, die bisher funktioniert haben, gehen offenbar nicht mehr. Der Anteil der Jugendlichen in einer Klasse, die zunehmende Schwierigkeiten im emotionalen und sozialen Bereich entwickelt haben, ist sehr gestiegen. Zunehmend sind Lehrpersonen überfordert, aber auch ratlos.
Dies trifft auch für einige Eltern zu. Die allgemeine Angst, finanzielle Nöte und zunehmende Unsicherheiten sind enorm gestiegen. Angst wird von den Medien auch geschürt. Positive Infos jeglicher Art sind in den Medien so gut wie nicht mehr zu finden.
In erster Linie sollten wir versuchen, zu erkennen, was uns diese Zeit sagen möchte. Denn schauen wir die Weltgeschichte an. Alle dramatischen Ereignisse hatten einen Sinn. Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Botschaften verstehen zu lernen.
Burnout: ein Thema für alle – auch Kinder und Jugendliche
Viele Aspekte, die ich zu besagtem Thema Burnout beschrieben habe, treffen für diese Zeit zu. Und selbstverständlich sind nicht nur Lehrpersonen und Eltern in Gefahr, sich derart zu überfordern, dass sie ein Burnout entwickeln können – Jugendliche ebenso. Vielleicht weichen die Symptome bei Jugendlichen etwas von denen bei Erwachsenen ab; vielleicht stehen hier mehr depressive, aggressive, «Null-Bock-» oder Rückzugstendenzen im Vordergrund. Alarmierend ist das genauso wie das typische Burnout des Erwachsenen.
Für mich ist es allemal ein Alarmzeichen, was zusätzlich zu oben Gesagtem im Zusammenhang mit Schulen Fragen aufwirft:
Inwieweit ist unsere Pädagogik noch zeitgemäss?
Ist der typische Unterricht noch zeitgemäss?
Sollte es vermehrt Möglichkeiten der Begegnung geben, bei denen sich jede Person (Schüler, Lehrperson) berührt fühlt?
Ist es ein Appell, Gemeinschaften neu zu greifen und neu zu kultivieren, die für alle verbindlich sind? Damit meine ich konkret die Klassen- und die Elterngemeinschaft in einer Klasse.
Ist es ein Appell, dass wir näher zusammenrücken sollen?
Nach dem Motto «Ohne Eltern schaffen wir das nicht»: Wie binden wir alle Eltern verbindlicher ein? Denn die zunehmenden Schwierigkeiten des Einzelnen sind nur gemeinsam zu lösen.
Ohne die Beteiligung der Eltern, sich für die Pädagogik nicht nur zu interessieren, sondern ganz hinter ihr zu stehen, werden wir die auf uns zustürmenden Ereignisse nicht überwinden.
Es ist eine spannende aber auch eine ernste Zeit, die Mut, Optimismus und Schöpferkraft verlangt, nicht zu «reformieren», sondern dem Zeitgeist entsprechend neue Wege zu gehen.
Wie sagte Friedrich Schiller?
Wage deinen Kopf an den Gedanken,
den noch keiner dachte.
Wage deinen Schritt auf den Weg,
den noch niemand ging.
Auf dass der Mensch sich selber schaffe,
und nicht gemacht werde,
von irgendwem oder irgendwas.
Michael Seefried, Oktober 22
Gewalt
Der Mensch, der nicht geachtet wird, bringt um
Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944, bei einem Aufklärungsflug abgestürzt, abgeschossen?)
Gewalt – eine archaische Kraft in uns
Ein paar Gedanken zur Einstimmung auf das Thema:
Solange es Menschen gibt, gibt es Gewalt.
Und es gab schon immer Menschen, die Gewalt befürworteten und solche, die sie ablehnten.
Für Eltern: wann beginnt Gewalt im Kindesalter? Inwieweit dürfen
oder sollen Kinder gar raufen (dürfen)?
Welche Vorbilder zum Thema Gewalt erleben eure Kinder?
In den letzten 10 Jahren beispielsweise ist die Gewalt in der Schweiz und in Deutschland gesunken, die Gewalt durch Jugendliche jedoch drastisch gestiegen, teilweise um bis zu 300%! In Deutschland hat jeder fünfte 15 jährige mindestens einmal eine Person krankenhausreif geschlagen! Und dies trotz intensiver «Antigewaltprogrammen».
Gewalt ist eine archaische Kraft, die in jedem Menschen schlummert.
Immer mehr Menschen in den Industrienationen neigen dazu, Gewalt abzulehnen, doch ist es so einfach?
Allerdings wurde in der Schweiz die Abstimmung, ob jeder Schweizer seine Militärwaffe zu Hause behalten soll, mit 2/3 abgelehnt. Durch meinen Praxisalltag kenne ich wenigstens 10 Familien, in denen ein Jugendlicher oder junger Erwachsener sich mit der Militärwaffe des Vaters das Leben genommen hat.
Meine Brüder und ich haben uns über mehrere Jahre sehr heftig und regelmässig geprügelt. Es blutete meist jemand, oft ging auch zu Hause etwas kaputt wie eine Scheibe oder eine Tür. Es war eine Phase, die genauso schnell aufhörte wie sie begann. Unsere Eltern haben uns das nicht verboten, jedoch begleitet. Wie von Zauberhand war diese Phase nach ein paar Jahren verschwunden. Waren wir gewalttätig?
Hätte man uns gefragt, wir hätten es weit von uns gewiesen…
Interessant ist, dass wir 5 in unserem Umfeld, Konflikte nicht durch Prügeleien «regelten» wie zu Hause. Mein ältester Bruder und ich waren im Jugendalter in der Schule bekannt für unsere guten vermittelnden Qualitäten.
Die Prügelei in meiner Kindheit hat mich den Umgang mit meinen Aggressionen und meiner Wut erfahren lassen und mich gelehrt, Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Daher bin ich für diese Erfahrungen sehr dankbar.
Jeder war mal Täter und mal Opfer
Wenn wir eine Lebenseinstellung haben, dass es wiederholte Erdenleben gibt, wird uns rasch klar, dass wir sowohl Täter- als auch Opferleben durchlebt haben. Durch Rückführungen lässt sich das aufzeigen. Es ist sehr hilf- und lehrreich, wenn jeder einmal auf diese Weise ein Täterleben und auch ein Opferleben am eigenen Körper rlebt, also wie es sich anfühlt, Täter oder Opfer zu sein.
Wenn mir das soziale Miteinander mit einem Menschen ganz besonders schwer fällt, kann ich davon ausgehen, dass ich mit diesem Menschen in einem vergangenen Leben bereits zu tun hatte.
Definition:
Das Wort «Gewalt» kommt aus dem Althhochdeutschen «waltan», was soviel bedeutet wie «stark sein», «beherrschen».
Bei Gewalt geht es offenbar darum, klar zu machen, wer die stärkere Person ist und meist etwas zu verteidigen, ein Territorium, einen anderen Menschen, das Recht auf etwas…
Angst und Aggression sind Gefühle, die oft mitschwingen, Wut nicht immer.
Ab wann sprechen wir von Gewalt?
Wir sprechen bisher von körperlicher Gewalt, jedoch gibt es auch seelische, psychische Gewalt. Diese kann viel subtiler sein, also in ihrer Wirkung auch dramatischere Folgen haben…
Die häusliche Gewalt ist bei uns wie in allen Ländern ein grosses Thema, Tendenz steigend. Im Jahr 2020 wurden in der Schweiz ca. 11500 Fälle offiziell registriert, davon 8100 betroffene Frauen und 3400 Männer , davon ca 30 Tötungsdelikte, auch die meisten Frauen.
Gewalt beginnt dann, wenn ich mein Gegenüber mit Absicht körperlich und/oder verbal bezwinge zu einer Handlung, die mein Gegenüber nicht will. Oft wiederholen sich solche Szenen in einem Haushalt. Eine einmalige Gewalteskalation ist eher selten.
Nicht jede Gewaltäusserung muss traumatisierend wirken, das wird individuell sein und kommt auch auf die Schwere der Gewalteinwirkung an.
Auch ist es möglich, dass jemand eine Erfahrung einer Tat macht, die von aussen betrachtet so schlimm nicht gewesen ist, bei der betroffenen Person aber ein starkes Gewalterlebnis auslöste.
Oft finden wir bei Menschen, die gewaltbereit sind oder Gewalt anwenden, in ihrer Vergangenheit entsprechende Erfahrungen.
Wie kann Gewalt oder können Gewalttendenzen überwunden werden?
Selbstverständlich sollten wir alle eine gewaltfreie Haltung einnehmen, also uns vornehmen, stets ohne Anwendung von Gewalt durchs Leben zu gehen. Jeder Konflikt, der nicht in einer kultivierten Weise gelöst wird, hat die Ladung in Gewalt zu eskalieren. Damit meine ich, dass die Gesprächspartner eine respektvolle Bereitschaft zum Dialog haben sollten und eine gemeinsamen Lösung anzustreben.
Allerdings können wir das nur, wenn wir gelernt haben, mit Gefühlen der Wut, der Aggression, des Hasses umzugehen. Sie abzulehnen hat eine fatale Wirkung ins Gegenteil.
Daher ist es wichtig, dass schon Kinder lernen mit diesen Gefühlen umzugehen und begreifen, dass sie immer Teil ihres Lebens sein werden. Kinder müssen sich richtig raufen dürfen, insbesondere die Jungs scheinen dies eher zu brauchen als die Mädchen.
Jeder Mensch ein potentieller Mörder?
Jeder von uns kann zum Mörder werden! Jeder Mensch sollte diese Erkenntnis realisieren!
Wir alle, je nach Temperament und Charakter stärker oder schwächer ausgeprägt, haben diese geballte archaische Kraft in uns schlummern, die hoffentlich nie zur Anwendung kommen muss. Das heisst, sie ist nicht weg, sie schlummert vor sich hin, solange das Leben einigermassen in seinen Bahnen läuft, besteht auch kein Bedarf, diese schlummernde Kraft zu wecken.
Lass die Umstände sich dramatisch entwickeln, Du bist halb verhungert und halb erfroren, Zukunftsperspektiven zeichnen sich keine ab, ein über alles geliebter Mensch (Kind, PartnerIn) ist in akuter Gefahr missbraucht und umgebracht zu werden. Wer die Möglichkeit hat, wird an dieser Stelle mit all seiner Kraft eingreifen. Dabei ist der Fokus das Überleben und Retten der geliebten Person.
So lange wir Gegenden in der Welt haben, in denen der Lebensalltag überwiegend menschenunwürdig ist, wird Gewalt präsent sein.
Solange das soziale Miteinander auch bei uns, Macht- und Egoismusbestrebungen aufweist, besteht die Gefahr einer Eskalation von Gewalt, wie wir täglich feststellen.
Kultivieren wir die arachaische Kraft Gewalt!
Wir können Gewalttendenzen minimieren, in dem wir das soziale Miteinander, die Beziehung zwischen Ich und Du kultivieren und üben.
Allerdings dürfen wir «gewaltfrei» nicht mit antiautoritär in der Kindererziehung verwechseln. Die antiautoritäre Erziehung der 60er/70er Jahre oder besser der Versuch einer antiautoritären Erziehung hatte dramatische Effekte genau ins Gegenteil. Kinder- und Jugendpsychiater hatten noch nie so viele traumatisierte oder verstörte Kinder gesehen wie zu jener Zeit.
Warum? Weil durch diese theoretisch erdachte Erziehungsmassnahme, die ja letztendlich ein Schrei nach Befreiung von der bis dato autoritären Erziehung war, die Kinder völlig orientierungs- und haltlos wurden. Sie hatten nichts mehr, an dem sie sich orientieren konnten..
Zur Erinnerung: als ich die Grundschule besuchte, waren Ohrfeigen von Seiten der Lehrer noch ein legitimes Erziehungsmittel.
Wie können wir die soziale Beziehung üben?
Am besten im Alltag und als erstes mit Mitmenschen, die uns emotional nicht so nah sind, beim Einkaufen, in der ÖV, ….
Allerdings sind unsere Kinder oder PartnerInnen unsere besten «Lehrmeister»!
Was eine soziale Beziehung misslingen lässt, ist, dass ich mich von den aufkeimenden Gefühlen überrumpeln lasse und mein Verhalten sich mehr oder weniger ungefiltert danach ausrichtet.
Wenn es mir gelingt, mehr bei mir zu sein, so leiten nicht die Gefühle mein Verhalten sondern ich bleibe «Chef» meiner Gefühle und mir gelingt den Raum zwischen einem Reiz und einer Reaktion zu gestalten. Je mehr mich der Reiz emotional aufwühlt, desto grösser ist die Herausforderung diesen Raum zu gestalten.
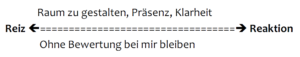
Eine soziale Beziehung wird mir schliesslich dann am besten gelingen, wenn ich eine solche zu mir selbst entwickeln konnte.
So kann es mir am ehesten gelingen, Herr meiner Gefühle zu bleiben, in mir weiter zu ruhen, auch wenn ein schlimmes Ereignis gerade auf mich einstürzt.
Ich werde im Alltag spüren, wo es mir gut gelingt, wo weniger und wo vielleicht schlecht. Und ich kann erkennen lernen, was mir guttut auf diesem Weg. Den einen hilft Sport oder Meditieren oder regelmässig in der Natur sein oder Yoga, Tai-Chi oder anderes. Anderen vielleicht «einfach nur zu sein». Eine gute Hilfe, die ich so kennengelernt habe, ist die Körperintelligenz (Karl Grunick «Entdecke deine Körperintelligenz»).
Mit dem Wahrnehmen meiner Körperintelligenz lerne ich den Botschaften meines Körpers zu lauschen und sie richtig zu verstehen.
Diese Überlegungen können ein erster Schritt im Umgang mit Gewalt sein, beginnend bei mir selbst und dann auf der kleinsten möglichen sozialen Ebene, zwischen einem Ich und einem Du.
So möchte ich mich Petra Kellys Worten anschliessen:
Gewalt hört da auf, wo Liebe beginnt
Petra Kelly
(1947-1992, erschossen, Gründungsmitglied der Partei die Grünen)
Die stärkste zwischenmenschliche Kraft, die uns gelingen hilft, ist die Liebe, die Liebe zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen, mit denen ich übe, den Raum zwischen Ich und Du zu gestalten, so, dass ich die Gewalt als archaische Kraft in meinem Alltag nicht mehr brauche.
Dies kann in jeder Lebenssituation gelingen, auch in der aussichtslosesten wie Viktor Frankl, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela
und andere uns vorlebten.
Es wäre spannend, dass Thema Gewalt in der Schule in diesem Sinne zu thematisieren, vielleicht sogar mal eine Epoche oder gar ein Theaterstück zum Thema zu geben inkl. der Übungen, wie soziale Beziehungen, in erster Linie zu mir selbst und dann zum Du, gelingen können.
Michael Seefried, Februar 2022
Was ist Liebe?
Die Liebe ist ein Erleben des anderen in der eigenen Seele.
Rudolf Steiner
Über Liebe zu schreiben, ist wohl das schwierigste überhaupt. Mir gelingt es nicht, Liebe genau zu umschreiben und ich kenne keine Beschreibung, die es wirklich «auf den Punkt bringt».
Ich wünsche jeder Leserin und jedem Leser, das sie an sich erfahren durften, was Liebe bedeutet, wie es sich anfühlt, zu lieben und geliebt zu werden. Wenn Sie das einmal erfahren haben, wissen Sie in der Regel ganz genau, wovon ich spreche, und zwar körperlich, seelisch und geistig!
Liebe ist die grösste Kraft und die grösste Gnade zugleich. Sie ist bedingungslos, alles durchdringend wie Wärme und Begeisterung, freilassend, nicht einengend, nicht fordernd, nicht «wenn, dann..»
Liebe kennt keine Schranken, keine Hemmnisse, keinen Egoismus, keine Machtbestrebungen, wenn sie da ist, ist sie da ohne «Wenn und Aber».
Liebe kennt keine Polarität oder Dualität, sie impliziert Klarheit, Authentizität und Offenheit.
Liebe kennt keine Rassen, keine Hautfarbe, keine Kultur, keine Religion, weder Armut noch Reichtum. Liebe durchdringt alle Menschen oder kann alle Menschen durchdringen, überwindet alles scheinbar unüberwindliche.
Liebe hat nichts mit verliebt sein zu tun. Es ist nicht das tiefe Gefühl der bedingungslosen Liebe. Liebe kann sich jedoch daraus entwickeln.
Wenn wir frisch verliebt sind, sind wir in der Regel nicht ganz klar. Wir sehen die Welt in einem «rosaroten Schleier», blenden einen Teil der Realität aus, auch Verhaltensmuster unseres geliebten Gegenüber, die wir oftmals nur 6 oder 12 Monate später nicht mehr ohne weiteres tolerieren.
Liebe ist auch eine Haltung und eine Entscheidung.
Wenn es mir gelingt, innerlich «in Liebe zu sein» (sorry die holprige Ausdrucksweise, sie ist bildhaft gesprochen und Absicht) werde ich beginnen, die Welt mit anderen Farben, anderen Konturen, zu sehen. Es wird meine Haltung dem Leben gegenüber, meine Gedanken und Gefühle beeinflussen. Mit Liebe kann ich viel eher bei mir sein. Kein Ereignis wird mich ganz aus der Bahn werfen können.
So kann ich mich entschliessen, «in der Liebe zu sein», wenn es mir gelingt, sie wirklich zu leben und nicht vom Kopf her zurecht zu legen.
Liebe ist die tiefste Lebensqualität, das tiefste Gefühl, dass ich erfahren kann. Mit ihrer Hilfe kann ich beginnen, mich innerlich mit Urteilen zurückzuhalten, egal was geschieht, und mir vornehmen, erst einmal die Geste lesen zu lernen, von dem was da gerade geschieht. Mit Liebe gelingt mir ein entscheidender zukunftsfähiger Beitrag in der Neugestaltung des sozialen Miteinander, des «Ich und Du» zu entwickeln.
Die Liebe herrscht nicht, sie bildet. J.W. von Goethe
Ist jeder zur Liebe fähig?
Liebe gibt es überall. Ich denke, ich kann sie nur in der Welt finden, wenn ich sie in mir entdeckt habe und lebe.
Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch auf die Welt kommt mit der Fähigkeit zu lieben und Liebe zu empfangen. Allerdings kann es im Laufe der Jahre durch gravierende Erfahrungen zu einer Störung oder Ablehnung der Liebesfähigkeit kommen. Manchmal ist es auch denkbar, dass wir mit einer solchen «Störung» auf die Welt kommen, diese also aus einem anderen Leben mitbringen.
Wenn ich merke, dass ich mich nicht ganz einlassen kann auf mich selbst oder auf mein Gegenüber, ist es sicher lohnenswert, die Ursachen dazu zu suchen und mir auch therapeutisch helfen zu lassen.
Wenn Liebe in unserer Beziehung und in meinem Leben uneingeschränkten Platz haben kann, unterstützt das mein Gegenüber in seinen Stärken und hilft Schwächen zu überwinden. Es gibt dem sozialen Miteinander ein Fundament und eine unermessliche Kraft. So gesehen unterstützt die Liebe in einer Beziehung die Entwicklung meines Gegenüber und die Beziehung zwischen «Ich und Du». Hier meine ich nicht nur die partnerschaftliche Beziehung. Es sollte selbstverständlich eine allumfassende Liebe sein, die nicht an Bedingungen geknüpft ist.
Ist Liebe in der Welt möglich?
Das ist die einzige Chance, das die Menschheit überlebt, so mein Eindruck. Die letzten Jahrhunderte haben gezeigt, dass Materialismus, Geldgier, Egoismus und Machstreben immer mehr politische Geschicke leiten.
Schaut Euch um in der Welt: der Ukrainekonflikt, das ehemalige Jugoslawien, Bürgerkriege wie z.B. in Äthiopien, Sudan, Nigeria, Kongo oder die Abholzungen im Amazonas, die Kriege in Irak, Libyen, Libanon oder Israel um nur einige zu nennen. Es finden Verbrechen statt im «Ich und Du» sowie im grösseren Kontext, die nie gesühnt werden.
Was treibt die Menschen zu solchen Greueltaten? Letztendlich Geld, Macht sowie egoistische Gier. Da hat Liebe keinen Platz!
Was können wir tun, damit eine Politik der Liebe – Liebe in der Politik entstehen kann?
Braucht die Menschheit Kriege, um in ihrer Entwicklung voranzuschreiten? Braucht die Menschheit praktische Erfahrungen im
Erleben von Greueltaten? Bisher scheint es so zu sein.
Wenn wir Zeitzeugen hören, stellen wir fest, dass die Menschheit sich durch das Durchleben des 2. Weltkriegs enorm weiter entwickelt hat.
Und Corona und die Liebe?
Die Wirrungen um Corona fordern uns auf, in unserer Menschheitsentwicklung weiter zu schreiten und das soziale Miteinander neu zu gestalten, gar zu transformieren. Wir sind jetzt gefragt, ob wir diese Herausforderungen wieder durch kriegerische Auseinandersetzungen wie «üblich lösen» wollen, oder ob wir bereit sind, andere Wege zu gehen.
In jedem von uns schlummern Gewaltbereitschaft und Aggressionen.
Wie gelingt es uns, diese wichtigen archaischen Gefühle so zu kultivieren, dass sie auch in Zeiten, in denen es uns schlecht geht, nicht mit uns durchbrennen?
Die Entwicklung des Dialogs statt Polarität oder das Nicht-Verurteilen einer Täter-Opfer Beziehung sind nun gefragt. Das soziale Miteinander, die Beziehung zwischen «Ich und Du» will neu gegriffen werden, unserem Zeitalter gemäss.
Jeder von uns ist aufgerufen, mitzuwirken und mitzugestalten im Alltag. Denn die grösste Wirkung einer Transformation auf der mitmenschlichen Ebene ist die «Ich-Du»-Ebene. Ich muss immer im Kleinen, also im «Ich-Du» anfangen, um Grosses bewirken zu können.
Daher – die nächsten Schritte unserer Menschheitsentwicklung können sich nur realisieren, wenn jeder von uns bereit ist, aktiv seinen Alltag in diesem Sinne umzugestalten und möglichst viele Menschen seines Umfeldes dafür zu begeistern es gleich zu tun.
Rudolf Steiner weist auf die enge soziale Verbindung in der Liebe hin. «Erleben des anderen in der eigenen Seele» kann nur gelingen, wenn ich die Person, die ich liebe in meiner eigenen Seele erlebe! Welches Erlebnis! Das kann doch eigentlich nur gelingen, wenn ich die Seele meines Gegenüber mit dem grössten Respekt und der grössten Achtsamkeit in mir aufleben lasse, ohne diese Persönlichkeit in irgendeiner Weise verändern zu wollen.
Ein ernstgemeinter Dialog mit offenem Herzen impliziert «sehen und gesehen werden» und ist die wichtigste Voraussetzung einer Begegnung und so auch Beziehung zwischen «Ich und Du» und hilft mir, mich meinem Gegenüber zu öffnen, so wie das mein Gegenüber sich mir öffnen kann. Dies trifft für jede Begegnung und Beziehung zu, für die Liebesbeziehung ist sie Fundament und Voraussetzung.
Begegnung als Heilungsimpuls gelingt mit Liebe. Begegnung mit Liebe
heilt!
«Der Tod hebt das reine Ich heraus – er ist Spender tiefren Seins»
Der Tod – was ist der Tod?
Ein Spender tiefren Seins;
Man fällt nicht aus der Welt,
man wird erst mit ihr eins.Der Tod ist heiliger als alle andren Engel.
Er hebt das reine Ich heraus am Grab der Mängel.Der Tod macht dich so still,
dass Gott dich hören kann.
Im Tod fängt unser Ich ja erst zu klingen an.Theowill Uebelacker
Dieses Gedicht hat mich tief berührt, weil es die Wirklichkeit um den Tod so treffend beschreibt.
Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt auch
Ich glaube, dass unser Leben farbiger und menschlicher wird, wenn wir die Toten bzw. den Tod als wichtiges Ereignis in unser Leben mit einbeziehen.
Bei meiner ärztlichen Tätigkeit gehören Geburt und Tod dazu. Da ich viele Jahre auf einer Intensivstation für Neu- und Frühgeborene gearbeitet habe, habe ich die Geburt tausender Babys miterleben dürfen wie auch das Sterben in jedem Lebensalter.
Alle diese Ereignisse, ob Geburt oder Tod, sind sehr individuell, es sind feierliche, ja weihevolle Momente. Wenn es die Umstände erlaubten, haben wir – das Personal – für einen kurzen Moment inne gehalten, um diesem besonderen Moment Raum zu geben.
Geburt und Tod sind Schwellenübertritte im Leben. Sie gehören zum individuellen Leben dazu. Daher ist es richtig und wichtig, dass Geburt und Tod in unserem Leben einen besonderen Raum, ja einen Kult einnehmen. Die Art, wie wir auf die Welt kommen und wie wir sterben, sagt etwas über unsere Individualität aus, wenn es medizinisch nicht zu sehr beeinflusst wurde.
Umgang mit Verstorbenen – wie beziehe ich sie in meinen Alltag ein?
Der Tod eines geliebten Menschen ist ein Verlust, der schmerzt und eine Lücke hinterlässt. Unsere Trauer ist sehr berechtigt, aber wir sollten versuchen, nicht in ihr zu versinken.
Ich denke, es ist wichtig, wenn wir Dankbarkeit entwickeln, den verstorbenen Menschen gekannt zu haben, mit ihm einen gemeinsamen Weg gegangen zu sein, auch wenn es sehr konfliktreich gewesen sein sollte.
Nach dem Versterben eines geliebten Menschen sollten wir versuchen, Konfliktinhalte beiseite räumen. Denn, wenn ich mich noch mit solchen Inhalten verbinde, binde ich mich weiter an den Verstorbenen. Dabei zählt es jetzt loszulassen und zu reflektieren, welche Möglichkeiten der Erkenntnis sich für mich ergeben durch die Beziehung, die ich mit dem Verstorbenen hatte, so schön oder schwierig sie gewesen sein mag. Wenn wir versuchen, die Gesten des Konfliktes zu verstehen ohne zu beurteilen, können wir oftmals erstaunliches entdecken und nicht selten zeigt sich diese Erkenntnis als Kraftspender oder gar Wegweiser für unser Dasein.
Um die Verbindung mit dem Verstorbenen in würdiger Weise der Realität anzupassen, könnte ich für eine gewisse Zeit Dinge tun, die der Verstorbene gerne gemacht hat, wie z.B. sein Lieblingsbuch lesen oder seinem Hobby nachgehen. Ich kann versuchen, mit den Augen des Verstorbenen zu schauen. Bei allen Schwierigkeiten, die sich da zeigen mögen, dürfen wir unseren Humor nicht vergessen, der unser Leben lebendiger erleben lässt.
In meinen Alltag beziehe ich Verstorbene mit ein: Was würdest du jetzt zu dem Problem sagen? Wie würdest du darüber denken, fühlen oder handeln?
Immer wieder habe ich erlebt, dass ich entweder die angesprochenen Verstorbenen unmittelbar erlebt oder aber ihre Botschaften geträumt oder als Bilder, Stimmungen oder Gedanken wahrgenommen habe. Verstorbene können unseren Willen und unsere Handlungen beeinflussen, wenn wir dies zulassen und der Präsenz unserer Verstorbenen in unserem Leben gewahr sind.
Wie begleite ich einen frisch Verstorbenen?
In den Kirchen und in der Gesellschaft ist es üblich, drei Tage Totenwache auszuüben, um dem Toten den Übergang zu erleichtern. Drei Tage braucht die Seele, um sich ganz vom Körper zu lösen. Aber mit welcher Logik machen wir so was, wenn danach sowieso «Schluss» sein soll, also wenn wir nur einmal auf dieser Welt leben?
Ich darf euch ermuntern nichts zu glauben, sondern Verhaltensweisen der Menschen und der Gesellschaft sowie Glaubenssätze kritisch zu hinterfragen.
Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Eltern begleiten durfte, als sie gestorben waren. In den drei Tagen habe ich erstaunliche Erfahrungen und Erkenntnisse machen dürfen. So habe ich mich neben das Gesicht von Mutter bzw. Vater gesetzt, mal auf deren rechte, mal auf deren linke Seite. Ich war völlig verblüfft, festzustellen, dass sich ihre Mimik veränderte, mal liebevoll, mal grimmig, mal wütend, als ob sie mit mir gesprochen hätten. Die rechte Gesichtshälfte strahlte etwas völlig anderes aus als die linke.
Bei der Totenwache kann man den Verstorbenen etwas aus der Bibel vorlesen oder aus einem Lieblingsbuch, man kann auch etwas erzählen oder gemeinsam über den Verstorbenen sprechen, man kann singen oder musizieren. «Mucksmäuschenstill» muss es nicht sein, jedoch sollte die Totenwache als besonderes Ereignis würdig und feierlich gestaltet werden. Ich wünsche jedem von euch, solche Erfahrungen machen zu dürfen.
Wie ist es mit der Reinkarnation?
«Glaubst du an die Wiedergeburt?» werde ich immer wieder gefragt. Ich glaube grundsätzlich nichts, was gesagt oder gedacht wird. Ich orientiere mich an dem, was sich mir schlüssig zeigt. Die Frage der Wiedergeburt ist für mich keine Frage des Glaubens sondern der Lebenstatsachen. Daher sammle ich gerne Lebenstatsachen, um daraus eine Erkenntnis zu entwickeln.
So können wir immer wieder verwundert feststellen, dass Kinder, die nicht durch eine strenge Konfessionsreligion oder durch das Belächeln der Erwachsenen verdorben wurden, die Existenz einer anderen Welt in der Regel als selbstverständlich erleben. Die Dipl.-Psych. Erika Schäfer hat in ihrer jahrzehntelangen Arbeit erstaunliche Erfahrungen gesammelt, die sie in ihrem Buch «Mama glaub mir, ich habe schon einmal gelebt» zusammengetragen hat. Menschen, die durch Reanimation «zurückgeholt» wurden, berichten über ähnliche Erfahrungen.
Das Leben ist für mich freudiger, schöner, gerechter, liebevoller, sinnvoller, weisheitsvoller aber auch strenger und verantwortungsvoller, wenn wir nicht nur einmal auf die Welt kommen sondern in mehreren Leben die Möglichkeit erhalten, unsere Lebensaufgaben, die wir uns gestellt haben, zu erfüllen. Ich konnte mir bereits als Kind nicht vorstellen, dass der liebe Gott so einfältig ist und uns nur ein einziges Mal auf die Welt kommen lässt, um anschliessend auf «Nimmerwiedersehen» zu verschwinden.
Die 10 Gebote und die Möglichkeit sich von den Sünden zu befreien, ist eine wichtige Möglichkeit der Menschen der letzten Jahrtausende gewesen, sich im Leben zurecht zu finden, zu lernen, in Polaritäten zu leben, dass es «gut und böse» gibt, Täter- und Opferbeziehungen usw. Das waren Themen der letzten Zeitepoche, und das war richtig so für die Entwicklung der Menschen damals.
Heute sind wir in einer neuen Zeitepoche und aufgerufen, die 10 Gebote in uns lebendig zu tragen wie auch Konflikte zu lösen, ohne in Polaritäten abzudriften, also Polaritäten zu überwinden und stattdessen mehr die Gesten der Ereignisse verstehen zu lernen. Diese sind es, ein umfassendes Verständnis für Gesamtzusammenhänge zu erfahren.
Haben wir eine Entscheidung getroffen, dass etwas falsch oder richtig ist, blenden wir einen Teil unserer Wahrnehmung aus. «Urteil macht eng» könnte man sagen.
Wir sind und bleiben selbst verantwortlich für unser Handeln – eigentlich immer. Und das ist gut so!
Die «Erlösung» durch die Beichte ist kein Freibrief, uns unserer Verantwortung zu entziehen. Auch dürfen wir nicht vergessen, welche Macht die Kirche über Jahrhunderte auf die Menschheit ausgeübt hat und wieviel Millionen Menschen ihr zum Opfer gefallen sind. Wie oft hat die Kirche die Definition von Recht und Unrecht, also von richtig und falsch, gut und böse für sich in Anspruch genommen. Wer anders dachte oder handelte, wurde in der Regel verfolgt oder getötet.
In der Bibel sind keinerlei Hinweise zu finden, die die Existenz der Reinkarnation ablehnen. Die Auslegung und die Bewertung zu diesem Thema ist Sache einzelner Konfessionen und liegt in deren Verantwortung, hat aber mit einem umfassenden Religionsverständnis, wie wir sie in der Bibel finden, oftmals nichts zu tun.
Geburt und Tod – in der irdischen und geistigen Welt
Wenn wir sterben, tauchen wir in eine andere Welt ein, ich nenne sie die geistige Welt. So ist ein Tod im jetzigen Leben, zugleich eine Geburt in der geistigen Welt und eine Geburt in unserem jetzigen irdischen Leben ein Tod in der geistigen Welt.
Es offenbart sich hier etwas, das wir Lebenszyklen nennen können. Im Verständnis, dass wir wiederholt leben, kann die Existenz der geistigen Welt, in die wir nach dem Tod eintauchen, schlüssig sein. Unsere Erfahrungen, die wir im irdischen Dasein gemacht haben, sollten irgendwo so aufgearbeitet werden, dass wir sie für eine kommende Inkarnation, also für ein künftiges Leben nutzen können. Auch dürfen wir davon ausgehen, dass wir uns etwas vorgenommen haben für dieses und für weitere Leben, dass wir erkennen und realisieren sollten.
So einfach ist es nicht unser Lebensthema heraus zu bekommen. Wenn wir jedoch aufmerksam unser Leben, unsere Biographie anschauen, werden wir feststellen, dass wir immer wieder Ereignisse und Begegnungen haben, zu denen eine bestimmte «Überschrift» passt. Da möchte sich offenbar ein roter Faden zeigen.
Ich meine, dazu gehört, dass wir mit Menschen, die uns heute sehr nahe stehen, in vergangenen Leben zu tun gehabt haben. Ist es vielleicht so, dass wir uns unsere Eltern, unsere Partner und unsere Kinder ausgesucht haben und die nicht «zufällig» bei uns sind? Oder umgekehrt wie Erika Schäfer in ihrem o.g. Buch eindrücklich beschreibt, dass die Kinder sich ihre Eltern aussuchen, um ihnen bei der Bewältigung gesetzter Lebensaufgaben behilflich zu sein. Diese Hilfe kann sich auch durch eine ausserordentlich schwierige konfliktreiche Beziehung Ausdruck verleihen.
So kann, wenn mir schlimmes angetan wurde, in einem neuen Licht erscheinen. Natürlich entschuldigt dies in keiner Weise irgendein Verhalten; doch kann sich ein anderes Verständnis für Lebenszusammenhänge entwickeln, selbst wenn die betroffene Person bereits verstorben ist. Mit dieser Betrachtung haben es die Menschen oft leichter, dramatische Erlebnisse zu verarbeiten, so meine Erfahrungen aus der täglichen Praxis.
Umgang mit Geburt und Tod in der heutigen Medizin – Leben und Tod um jeden Preis?
Die Geburten unserer Kinder werden immer mehr gelenkt, d.h. der Geburtsmoment wird durch wehenfördernde Medikamente oder einem geplanten «Wahl-« Kaiserschnitt manipuliert. Sog. Sonntagskinder werden immer rarer, weil wir durch Medikamente geschickt die Geburt lenken können. An dieser Stelle spreche ich nicht von den Geburten, bei denen medizinisches Eingreifen notwendig ist – dafür ist unsere heutige Medizin segensreich. Jedoch bedürfen ca 10% der Geburten eines Kaiserschnittes aus medizinischer Indikation. Wir haben aber mittlerweile eine Kaiserschnittrate von teilweise mehr als 50%.
In der Coronaära war es besonders eindrücklich zu erleben, wie die heutige Medizin den lebenspraktischen Zugang zur Realität verloren hat. Einerseits «Leben um jeden Preis», andererseits, wenn ich Organe brauche, erstelle ich mir eine Definition von Tod, die mir erlaubt, «wissenschaftlich» weiter vorzugehen.
In dem einen Fall werden schwerkranke, demente alte Menschen gegen Corona geimpft, wohl wissend, dass auch Geimpfte weiterhin ansteckend sein können. Und auf Intensivstationen werden alle «Register gezogen», um das «Leben» – was da noch Leben ist -, zu erhalten.
In dem anderen Fall neigen wir dazu, den schwer verletzten Menschen «toter» zu machen als er ist, denn ich will ja noch etwas von ihm – seine Organe.
Mit «toter» meine ich, dass wir uns der «wissenschaftlichen» Definition des Hirntodes bedienen, die den Menschen als tot bezeichnet. Es ist aber unschwer zu erkennen, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen einem Hirntoten, bei dem Lebensprozesse noch tadellos funktionieren und einem «wirklich Toten», bei dem alle Lebensprozesse beendet sind.
Wer mag beurteilen, ob ein Hirntoter noch ein Gefühlsleben hat? Nach welchen Kriterien mag das beurteilt werden? Ich möchte hier keine Diskussion zum Thema Hirntod und Transplantation diskutieren, ich möchte aber feststellen, dass die Wissenschaft nicht selten in einseitiger Weise Dinge für wahr festlegt und dabei wesentliche Merkmale nicht berücksichtigt oder nicht beantwortet.
Es ist sehr eindrücklich zu erleben, wenn sich Transplantationsteam und das Team der Intensivmediziner an einem Krankenbett gegenüberstehen. Dies habe ich verschiedene Male miterlebt.
Was tun wir da eigentlich? Ist es richtig, derart in Schwellenübertritte einzugreifen?
Es ist eine Frage der Freiheit, dass wir uns in unserem modernen Leben aus einer Erkenntnis heraus entscheiden, in bestimmten Situationen gerade nicht einzugreifen!
Im medizinischen Bereich ist diesbezüglich schon viel passiert, aber dies sollte noch weiter entwickelt werden.
Denn, wie werden alte kranke, vielleicht demente Menschen, die nicht mehr selbständig leben können intensivmedizinisch betreut? Wann ziehen wir da eine Grenze? Wer zieht die Grenze? Stehen organspezifische Defizite im Vordergrund? Finden biographische Lebenstatsachen eine Berücksichtigung? Auch wenn es mittlerweile Ethikkommissionen in den Kliniken gibt, wie oft kommen sie wirklich zum Einsatz?
Oder hätte eine Gynäkologin nicht die Pflicht, wenigstens zu versuchen, die werdende, sich ängstigende Mutter dahingehend zu begleiten, dass sie sich auf eine spontane Geburt freut anstatt ihre Ängste als willkommenen Anlass zu nehmen und ihr zu einem Wahlkaiserschnitt, der ja «viel sicherer» ist, zu raten?
Was genau ist sicherer in diesem Fall – doch lediglich der Akt der Geburt? Denke ich an das Kind, sein Schicksal und seine Biographie? Berücksichtige ich, dass eine Spontangeburt, zu der aus einer angstvollen Situation der Mutter die weise Gynäkologin doch geraten und intensiv begleitet hatte, vielleicht massgeblich die Mutter-Kind-Bindung in positiver Weise beeinflusst werden konnte?
Ob wir wollen oder nicht, bei solchen Schlüsselfragen übernehmen wir Ärzte eine grosse Verantwortung, die nicht selten ein ganzes Leben beeinflussen können.
Auch darf man bei solchen Betrachtungen die finanzielle Seite nicht vergessen. Ein Kaiserschnitt ist lukrativer als eine Spontangeburt und Intensivstationen brauchen eine hochprozentige Auslastung! Das ist nicht ketzerisch sondern leider Realität.
Ich gestalte die Umstände meines Todes – Patientenverfügung
Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Menschen immer bewusster leben und immer mehr eigene Entscheidungen treffen wollen. Ich nenne es das Zeitalter der Bewusstseinsseele. Das bedeutet, die Menschen wollen zunehmend alle Umstände des Lebens verstehen und nachvollziehen können. Zufällen wird nur noch wenig Spielraum gelassen. Dies zeigt auch die öffentliche Forderung, sich aktiv an der Gestaltung des eigenen Todes durch eine Patientenverfügung zu beteiligen. Es genügt heute nicht mehr, wenn Angehörige, die Haltung des sterbenden Menschen dem intensivmedizinischen Personal vermitteln.
Daher sollte jeder von uns festlegen, inwieweit er eine intensivmedizinische Begleitung und lebensverlängernde Massnahmen wünscht, wenn er schwer krank ist. Ich habe einige Patienten, die eine solche Verfügung auch explizit für die Coronaerkrankung festgelegt haben.
Der Tod ist eben «Spender tiefren Seins», im «Tod fängt unser Ich zu klingen an» wie im eingangs formulierten Spruch nachzulesen. Oder der Tod hebt das reine Ich heraus!
Geburt und Tod als Schwellenübertritte sind wesentlichste Ereignisse jedes Menschen. Sie zu würdigen ist genauso unsere Pflicht wie ihnen den Raum der Entfaltung zu geben ohne «dazwischen zu funken», weil wir sonst Leben manipulieren. Die Freiheit an dieser Stelle ist, der Grösse der Ereignisse den Respekt zu zollen, die ihnen gebührt, nämlich Geburt und Tod im Gesamtzusammenhang eines Individuums wahrzunehmen und danach zu handeln. Das ist gelebte Freiheit.
Denn durch den Tod erfahren wir etwas über das reine Ich als Spender tiefren Seins. Für mich trifft das für die Geburt ebenso zu!
Leben schliesst so gesehen, die beiden Schwellenübertritte Geburt und Tod mit ein, denn sie gehören nicht nur zum Leben – sie zeigen individuelles Leben auf.
Michael Seefried, Ostern 2022
Kränkung
«Mich kann niemand beleidigen, wenn ich es nicht zulasse»
Einerseits:
Kränkung, wer kennt dieses Gefühl nicht.
Eine Diskussion, ein Wort, manchmal nur eine Geste, und uns wird ganz heiss, Gedanken und Gefühle schiessen durch unseren Körper, sie überrennen uns, wir haben Mühe, uns zu kontrollieren, wir fühlen uns zunehmend elend, es wirft uns aus der Bahn …
Eine Kränkung ist immer ein Ereignis auf der Ebene einer Ich-Du-Beziehung. Mein Hund oder mein dreijähriges Kind beispielsweise können mich nicht kränken, denn die Ich-Du- Beziehung ist nicht auf Augenhöhe.
Kränkung ist meine Sache!
Mein Gegenüber ist in der Regel nicht dafür verantwortlich, dass ich sein Handeln als Kränkung empfinde. Die Kränkung, die sich bei mir einstellt, hat mit mir zu tun, mit meinen Erfahrungen, meiner Biographie, meinen Hürden oder Verstrickungen, die mir aufzeigen, wo ich noch verletzbar bin. Ich könnte meinem Gegenüber geradezu dankbar sein, dass es mich auf meine «Baustellen» aufmerksam macht.
Andererseits:
Die Welt wandelt sich mit grosser Geschwindigkeit, insbesondere seit Januar 2020. Damit verändern sich die sozialen Beziehungen zwischen Ich und Du sowie die Bildung von Gemeinschaften in privater und beruflicher Hinsicht rasant. Diese Neugestaltung ist erforderlich, um das alte Bewusstsein zu überwinden und hinter uns zu lassen. Die Gesellschaft und auch die Konfessionen der Religionen haben uns in diesem «Bewusstsein der Polaritäten» festgehalten, wie Betrachtungen über Sünde und die 10 Gebote aufzeigen: Gut-Schlecht, Richtig-Falsch sowie Gut-Böse wurden Richtwerte und Ideale.
Vorstellungen über Recht und Unrecht oder Moral wurden so zementiert. Diese waren in den letzten Jahrhunderten wichtig, damit die Menschen ein Gespür für Polaritäten entwickeln konnten.
Nun ist es an der Zeit, dass wir der Entwicklung von Gemeinschaften und der Ich-Du-Wir-Beziehung Raum für Neugestaltung geben. Das hat zur Konsequenz, dass sich der Inhalt von Begriffen wie Macht, Moral, Freiheit, Recht und Unrecht verändert. Ein Wandel des Bewusstseins, eine Transformation wird sich daraus ergeben. Das scheint unsere Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte zu sein.
Daher: Versucht mal den Gestaltungsraum in eurem Leben zu nutzen. Das ist im Prinzip jederzeit möglich, egal wie dramatisch oder akut eine Lebenssituation sein mag.
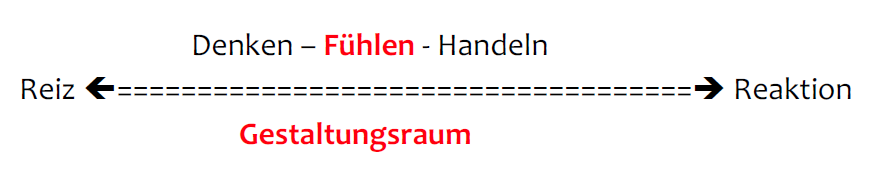
Je nach Situation habe ich mindestens einige Sekunden Zeit für den Gestaltungsraum, meist sogar etwas mehr. Konflikte müssen in der Regel nicht im Moment geklärt und besprochen werden. Das ist beruhigend. Denn so haben wir mehr Spielraum und emotionalen Abstand, um zu gestalten. Paare sollten sich regelmässig verabreden, z.B. ein Mal pro Woche oder alle 14 Tage, um sich über ihren Alltag auszutauschen – idealerweise in einem Moment der Ruhe ohne Kinder und ohne Telefon in einer wohlwollenden Atmosphäre.
Die wichtigste Qualität, wenn ein Reiz oder ein Ereignis auf mich einstürmt, ist das Fühlen.
Diesem Gefühl sollte ich den Raum geben, es wahr- und ernstzunehmen – allerdings ohne mich zu einer unmittelbaren Handlung treiben zu lassen. Vielmehr sollte mich das Gefühl leiten, die Handlung zu gestalten. Das Gefühl ist dann Mediator in meinem Gestaltungsprozess, der als Grundlage immer die Ich-Du-Beziehung hat. Wir kennen dies als Resilienz, dass wir ganz bei uns bleiben können, ohne die momentane Situation zu beurteilen. Menschen mit einer hohen Resilienz sind geübter und belastbarer in schwierigen Situationen.
Wie kann ich mich vor Kränkung schützen?
Nun werden wir feststellen, dass wir bei bestimmten Ereignissen («Reizen») noch verletzbar und im Widerstand sind. Es gibt Ereignisse, die «machen mich noch fertig»; da werden wir von der Wucht der Gefühle, die auf uns einstürmen, förmlich umgehauen.
Und so kennen wir auch Menschen, mit denen wir von der ersten Begegnung an im Konflikt stehen. In solchen Situationen fällt es uns schwer, den Gestaltungsraum zu bearbeiten.
Es ist nun eine Herausforderung, auf die Suche zu gehen, wo wir genau noch verletzbar sind. Wo gelingt noch Kränkung? Wo lebe ich noch im Widerstand? Warum habe ich mit diesem einen Menschen von Anfang an Schwierigkeiten, obwohl äusserlich nicht viel geschehen ist?
Dies impliziert eine Bedingung: Dass ich wirklich die Umstände ergründen möchte, wo ich noch verletzbar bin. Dieser Impuls muss von mir ausgehen. Ist dieser Impuls nicht eindeutig, werden therapeutische Bemühungen schwierig sein.
Für mich persönlich war es hilfreich, den Gedanken zuzulassen, dass wir Menschen uns in anderen Leben und anderen Zusammenhängen bereits gekannt haben und Konflikte vielleicht von dort in dieses Leben «rüberschwappen». Ich bin den Menschen dankbar, die mich gekränkt haben; durch sie habe ich viel gelernt.
In der therapeutischen Arbeit können wir erarbeiten, ob es Konflikte dieser Art gibt oder ob ein anderes Thema für ungelöste Hürden in unserem Leben sorgt. Es wird uns guttun, solche Hürden aufzulösen, damit sie unser Handeln nicht mehr beeinflussen können.
Wenn uns dies gelingt, wird es uns zunehmend emotional besser gehen; wir werden stabiler, ausgeglichener und freudiger durchs Leben gehen. Widerstände, die uns in unserem Tun immer wieder begegnet sind, werden verschwinden. So werden wir immer mehr ganz bei uns sein, ganz präsent und weniger verletzbar.
In der Regel sind wir «empfindlicher» auf Kränkungen bei Menschen, denen wir emotional nahe stehen wie PartnerIn, Kindern, Eltern, Geschwistern oder auch Grosseltern als jemand aus dem Einkaufsladen oder dem ÖV. Dies ist natürlich und kann uns auf dem Weg, innere Ausgeglichenheit zu üben, helfen. Unsere Kinder und unsere Partner sind in der Regel unsere besten Lehrmeister – gerade, weil sie uns emotional so nahestehen.
Gesellschaftliche Bedeutung und Verantwortung im Umgang mit Kränkung
Kränkung spielt in jeder Gemeinschaft eine grosse Rolle: ob innerhalb der Familie, in einer Schule, in einer Organisation oder in der Politik. Gerade in der Politik oder in ranghohen Positionen einer Organisation bin ich aufgerufen, verantwortungsvoll einer Aufgabe zu dienen. Oftmals stehen leider persönliche Bestrebungen, Egoismus und Machtgehabe im Vordergrund, wie wir das in der Politik oft antreffen. Diese trüben die Qualität der anstehenden Arbeit.
Daher ist es aus meiner Sicht Pflicht, dass gerade Personen in hohen Positionen und Politiker eine individuelle Entwicklung durchlaufen, bei der sie lernen, persönliche Bestrebungen, Egoismus und Machtgehabe zugunsten von Präsenz, innerer Ausgeglichenheit und Authentizität zu überwinden. In den entsprechenden Ausbildungsgängen sollte dies fester Bestandteil sein.
Der Umgang mit Kränkung hat daher nicht nur eine persönliche, sondern eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung. Jede ungelöste Kränkung kann den Boden für einen Konflikt und schliesslich für eine kriegerische Dynamik legen. Umgekehrt: Je stabiler und ausgeglichener jeder Einzelne von uns ist und somit unempfindlicher auf Kränkung, desto grösser der Beitrag für ein friedliches Miteinander. Dies wird uns im Moment exemplarisch vor Augen geführt: Putin als alleinigen Aggressor zu bezeichnen, verfehlt die Realität der Geschichte (siehe mein Artikel über die Ukraine in der Märzausgabe dieser Zeitschrift).
Die Gestaltung sozialer Beziehungen, die Ich-Du Beziehungen wie auch die Gestaltung von Gemeinschaften liegen – auch unter dem Aspekt einer Friedensbewegung – in der Hand jedes Einzelnen von uns. So gesehen haben wir es in der Hand, indem wir uns selbst reflektieren, schauen, wo wir noch verletzbar sind und dies aufzulösen versuchen.
Friedensaktivitäten jeder Art sind sehr lobenswert; doch, wie die Geschichte zeigt, werden sie keine nachhaltige und tiefe Wirkung haben. Die individuelle Stabilität und Präsenz und konsequenterweise einer Gesellschaft, auch im Umgang mit Konflikten und Kränkungen, wird Garant sein für jede friedliche Entwicklung. Anders wird es nicht möglich sein.
Kränkung in Pädagogik und Medizin
Eine grosse Bedeutung hat das Thema der Kränkung auch auf jeden Lern- und therapeutischen Prozess, auf Erziehung, Pädagogik und Medizin im Allgemeinen.
Je mehr meine innere Haltung wie Wertschätzung, Begeisterung und Humor meinen Lebensalltag im Umgang mit Kindern und Jugendlichen prägen, umso mehr ebne ich den Weg, Kränkungstendenzen wenig Platz einzuräumen. Dies funktioniert, wenn ich dies wirklich verinnerlicht habe: Nur dann kann ich authentisch und klar Vorbild sein. Sonst durchschauen mich die Kinder, und mein Verhalten wird als leere Hülle erlebt.
Sind meine pädagogischen Werte und Ziele eher Bewertung, Druck und Bestrafung, so helfe ich mit, einen fruchtbaren Boden zu schaffen, auf dem auch Kränkungstendenzen gut gedeihen können mit entsprechenden gesellschaftlichen Konsequenzen.
In der Medizin ist es ähnlich: Wie kann ich einen Patienten so begleiten, dass er das Gefühl hat, in jedem Moment Herr seiner Lebenssituation zu sein? Auch hier darf ich Vorbild sein, in der Vermittlung von Wertschätzung, Authentizität und auch Begeisterung, die enorme Hürde der individuellen Erkrankung ganz anzunehmen, damit ich aus dem Impuls der Annahme den Heilungsprozess gestalten kann. Das ist ein sehr komplexer und individueller Vorgang, der immer wieder eine unglaubliche Wirkung zeigt.
Wie sich bei vielen Menschen bereits gezeigt hat, wird die beschriebene Grundhaltung eine gesundheitsförderliche Wirkung haben und den individuellen Menschen in seinem Sein stabilisieren. Dies wird eine grossartige Auswirkung auf die Ich-Du-Beziehung, die Gesellschaft und das Miteinander der verschiedenen Kulturen haben.
Nur mit Humor kann ich am Leben angeschlossen sein.
Humor ist Lebensqualität, Lebenshaltung und Lebensgefühl. Humor gehört zum Leben wie Ernst, Fröhlich- oder Traurig sein.
«Humor ist die Begabung eines Menschen den Unzulänglichkeiten des Lebens und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen», kann man bei Wikipedia nachlesen.
Ich meine in diesem Artikel den echten Humor, nicht den, der andere bewertet oder verurteilt. Im Humor bin ich ganz mit dem Herzen dabei. Humor hat für mich eine bedeutende seelische Tiefe, die mich lebendig sein lässt, die mir hilft, am Leben angeschlossen zu sein.
Humor ist gesund:
Zudem ist Humor gesund: er ist immunstimulierend, unmittelbar messbar im Blutbild (!), er senkt den Blutdruck, reguliert den Hormonhaushalt, stimuliert die Gehirntätigkeit, wirkt stimmungsaufhellend und antidepressiv. Humor darf jeden Tag Platz in unserem Leben haben.
Humor und Lachen. Das Thema dieses Artikels ist Humor nicht lachen!
Lachen wird mit Humor oft in Verbindung gebracht, aber nicht jedes Lachen hat Humor und nicht jeder Humor braucht Lachen.
Die heitere Gelassenheit, die wir beim Humor erleben, ist keinesfalls oberflächlich.
Im Humor steckt Ernsthaftes, vor allem ist es eine urmenschliche Geste und Qualität. Humor impliziert meine Lebenshaltung: «ist das Glas halb voll oder halb leer». Damit meine ich: Breche ich emotional vor den Problemen, die sich mir im Leben stellen beinahe zusammen, scheinen sie also eine fast unüberwindbare Hürde zu sein oder sehe ich in jedem Problem das Potential einer Lösung, wie auch immer sie aussehen mag. Das ist einerseits ein Thema des Temperamentes und der Erziehung, andererseits welche Lebenserfahrungen sowie «Hürden» wir noch nicht überwinden konnten.
Mit Temperament meine ich die 4 Temperamente des Menschen, also den Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker. In der Regel leben wir insbesondere 2 dieser Temperamente, wobei eines im Vordergrund steht. Es ist natürlich, dass ein Choleriker oder Sanguiniker anders mit Humor umgehen als ein Phlegmatiker oder Melancholiker. Der Melancholiker sieht die Welt eher pessimistisch, neigt also eher dazu, dass Glas halb leer zu sehen als der Sanguiniker, der die Welt eher optimistisch sieht.
Dürfen wir Humor haben?
«Dürfen» wir in der derzeitigen Weltsituation humorvoll sein? Diese Frage höre ich immer wieder, und ich finde es sehr interessant, dass Menschen so etwas denken.
Ist Humor denn etwas verwerfliches oder oberflächliches, was man nur zu bestimmten Zeiten leben darf? Es fragt auch niemand, ob wir ernst oder traurig sein dürfen…
Was ist mit der Zeit vor dem Ukrainekrieg? Haben andere Kriege, die wir seit Jahrzehnten hinnehmen wie Iran-Irak, Israel und Palästina, Libyen, Afghanistan oder die weltweiten Hungersnöte, denen Millionen von Menschen zum Opfer fallen, einen anderen Stellenwert?
Globales Wohlbehagen: ist das ein erstrebenswertes individuelles und globales Ziel?
Besagt es, dass die Menschen glücklicher und zufriedener mit sich und der Welt sind? Und dann? Wird es dann noch Entwicklung geben? Sind nicht gerade Krisen
die besten Entwicklungshelfer? Schaumal in Deine persönliche Biographie und die Deiner Liebsten. Waren es nicht Krisen, die geschubst und weiter gebracht haben?
Wäre dann ein globales Wohlbehagen nicht einem Weltuntergang gleichzusetzen?
Zudem hat jeder von uns sein individuelles Schicksal und seinen individuellen Lebensauftrag. Das geht nicht immer mit Wohlbehagen einher.
Humor ist lebensnotwendig!
Humor ist nicht nur erlaubt, er ist lebensnotwendig, er gehört zum Leben wie Ernst, Traurigkeit, Aggression, Hass, Wut, Liebe, Freude, Glück….. Wir sind geboren mit all diesen Qualitäten, sie sind Teil von uns, unseren Stimmungen, die uns die Farben des Lebens geben und unsere Lebendigkeit. Sie machen erst unsere Lebendigkeit aus. So können wir uns fragen: was ist der Sinn des Lebens? Ich denke, es ist das Leben selbst mit all seinen Facetten, Herausforderungen, Hürden und Krisen. Und da gehört Humor wie die anderen genannten Qualitäten dazu.
Wer anstrebt, die eine oder andere Qualität eliminieren zu wollen, ist weltfremd und naiv. Alle diese Qualitäten wollen, ja müssen gelebt sein. Nur wenn ich sie kenne, kann ich sie kultivieren und so in mein Leben integrieren, dass ich niemandem schade und selbst offen und authentisch ganz mein Potential und meine Schöpferkraft leben kann. Daher ist es so wichtig, dass wir den Kindern den Raum geben, mit all diesen Qualitäten zu experimentieren, um sie an sich selbst und im Miteinander kennenzulernen.
Es gibt natürlich Momente, bei denen Humor unpassend ist wie bei den meisten Beerdigungen. Eine Ausnahme war die Trauerfeier des Clowns Dimitri in Locarno im Juli 2016, bei der der Humor sehr präsent sein durfte. «Mit Orgelklängen und unter dem Applaus der Trauergäste – unter ihnen Alt-Bundesrat Flavio Cotti, wurde der Sarg…auf den Vorplatz getragen. Schülerinnen und Schüler der Dimitri-Schule feierten hier nochmals ein buntes Fest..» aus TA Panorama vom 24.7.16
Ist das nicht eine rührende Würdigung für den Verstorbenen?
Humor und Gesellschaft – der «Arbeitsabsolutheitsanspruch»
In den Industrienationen ist Humor rückläufig. Woran liegt das? Ich kenne keine Studien, die dies fundiert untersucht haben, aber es ist in allen Ländern zu beobachten. Wenn ich mir selbst eine Antwort überlege, denke ich folgendes:
In den Industrienationen stehen Arbeit, Karriere, beruflicher Erfolg immer mehr im Vordergrund. Das ganze Leben muss sich danach richten wie Familienstrukturen, Partnerschaft, Beziehungen generell, immer frühere Fremdbetreuung unserer Kinder. Mit diesem «Arbeitsabsolutheitsanspruch» verlieren wir einen Teil unseres Lebens, denn mit dieser Haltung sind wir oftmals nicht mehr in der Gegenwart sondern mehr auf die Zukunft bezogen, wir machen uns nicht selten zum Sklaven unserer Arbeitswelt und verlieren die Lebendigkeit des Lebens. In der Tat sind immer mehr Menschen nicht mehr wirklich lebendig. Und unsere Kinder ahmen uns nach!
Ein weiterer Preis ist die deutliche Zunahme sog. Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall, Zuckerkrankheit, Gallensteine, und nicht zu vergessen, die rasant zunehmenden psychischen Entgleisungen und Krisen, begünstigt insbesondere durch Bewegungsmangel, ungesunden Stress, emotionale Unausgeglichenheit, zunehmend falsche da entfremdete Ernährung, zuviel Eiweiss, soziale Vereinsamung etc.
Wo bleibt dann das Leben? Kann es wirklich nur so gehen oder ist eine andere lebendigere Vernetzung und Gestaltung zwischen Arbeits- und Privatleben möglich? Ich beobachte, dass immer mehr junge Menschen nicht mehr 100% arbeiten, was zu meiner Zeit undenkbar gewesen wäre. Vielleicht ist das ein Anfang in die richtige Richtung? Denn vergessen wir nicht, dass Humor nur in der Gegenwart gelebt werden kann. Ich kann mir nicht vornehmen übermorgen nach der Mittagspause humorvoll zu sein. Humor geschieht aus dem Moment heraus als kreativer schöner Moment der Lebendigkeit, des Mensch-Seins.
Humor in Erziehung und im Heilprozess
Da Humor eine wichtige Lebensqualität ist, darf er auch nicht in der Erziehung oder im therapeutischen Prozess fehlen. Im Gegenteil, es ist ein Muss, dass Humor sowohl bei der Erziehung als auch im Umgang mit Kranken gegenwärtig ist – denn welch grössere Kraft gibt es, die uns hilft am Leben angeschlossen zu bleiben und uns lebendig zu fühlen als der Humor? Warum wohl sind Clowns in Kinderkliniken gegenwärtig?
Was wäre der Unterricht, der Lebensalltag einer Familie, die Gestaltung von Beziehung und Partnerschaft, ein therapeutischer Prozess ohne Humor? Eine
schwere Krise, eine Trauerphase kann ich mit Humor überwinden.
Alle Menschen brauchen Vorbilder, insbesondere Kinder und zwar nicht, was wir sagen, sondern sie orientieren sich an unserer Haltung, unserer Gesinnung,
unseren Gedanken und Gefühlen, unserer Authentizität und Klarheit, unserem Sein. So wollen sie auch sein, so lernen sie «aha so funktioniert die Welt».
«Humor ist wenn man trotzdem lacht».
Michael Seefried, Juni 2022
«Angst liegt nie in den Dingen selbst, sondern darin, wie man sie
betrachtet»
Anthony de Mello (1931 Bombay, Indien – 1987 New York, USA)
Angst als archaische Kraft
Angst ist eine archaische Kraft, die unser Leben begleitet. Sie gehört zu uns wie Liebe, Freude, Begeisterung, Enttäuschung, Frust, Aggression, Wut…
Angst lässt uns aufhorchen, macht uns wach, versetzt uns in Anspannung. Angst kann uns auf Gefahren aufmerksam machen und uns schützen. Angst ist dann unser Leibwächter, der uns begleitet.
Unser Körper geht in Alarmbereitschaft: Herzschlag und Atmung beschleunigen sich, wir schwitzen, die Körpertemperatur verändert sich, uns schnürt es die Kehle zu, uns verdirbt es den Appetit, uns kann schwindelig werden, wir können in die Hosen machen, ev. entwickeln wir Schmerzen, unsere Gedanken und Gefühle kreisen um das Angstthema…
Jedoch gibt es in uns eine Kraft, die diesem Zustand Einhalt gebietet.
Angst als Krankheit
Angst kann eine solche gigantische Kraft entwickeln, die unser Verhalten, unsere Gedanken und Gefühle, ja unser Sein steuert. Wir sind unserer Angst gegenüber schutzlos ausgeliefert, ohne dass wir etwas dagegen ausrichten können.
Dann ist sie eine Krankheit. Dann macht sie uns unfrei. Jetzt sollten wir alles daran setzen, dass wir wieder freie Menschen werden. Meist ist eine therapeutische Begleitung notwendig. Oftmals hilft es, wenn ich unter systemischen Gesichtspunkten versuche herauszufinden, warum die Angst eine solche immense Wirkung und Bedeutung in meinem Leben hat. Wer hat noch eine solche Angst in der Familie? Gibt es ev. Gründe, die eine solche Angst notwendig machen oder die sie begründen? Haben Familienangehörige Kriegserfahrungen gemacht, auch wenn sie 1-2-3 Generationen zurückliegen, können sie einen Einfluss auf uns selbst haben.
Wie kann ich mit Angst umgehen lernen?
Wir sollten versuchen, uns nicht gegen die Angst zu stellen. Hören wir ihr zu. Nehmen wir sie ernst und nehmen wir sie an. Was will sie uns sagen? Man sollte mit der Angst in einen inneren Dialog treten und herausfinden, was man braucht, wie wir uns schützen können und was uns Sicherheit bringt.
Dann ist es hilfreich über Angst zu sprechen, sich mit Freunden oder Familie auszutauschen.
Gerade jetzt, wo es in Europa wieder Krieg gibt, wird für viele Menschen die Angst zum Greifen nahe. Da ist es besonders wichtig, mit anderen im Austausch zu sein und andere Kräfte wie Zuversicht, Optimismus, inneren Frieden und innere Zentriertheit neben der Angst in den Fokus zu stellen.
Oft hilft der Austausch mit anderen, zusammen etwas unternehmen, singen, Musik machen, Sport treiben, Spiele…
Wir sind körperliche-seelische-geistige Wesen.
Wir sind körperlich, seelisch und geistige Wesen. Um meine innere Balance zu finden, ist wichtig, dass ich meiner drei Ebenen (Körper-Seele-Geist) als gleichzeitige und gleichwertige Qualitäten gewahr werde.
Immer wenn wir angespannt sind, sollten wir versuchen, uns wieder zu zentrieren, unsere innere Balance wieder zu erreichen. Karl Grunick nennt das Körperintelligenz («Entdecke deine Körperintelligenz»).
Wir können versuchen, wieder unseren Grundtonus einzunehmen. Das ist der «Wohlfühltonus», den ich in der Regel beim Meditieren einnehme. Wenn ich Angst habe oder wütend bin, ist mein Tonus erhöht (körperliche Ebene).
Dann sollte ich innerlich das Ereignis, was mir Angst macht, ganz annehmen und aufmerksam beobachten, was es mit mir macht (seelische Ebene).
Als drittes versuche ich nicht zu bewerten (geistige Ebene).
Wenn ich alle drei Ebenen gleichzeitig und gleichwertig lebe und erfahre, wird es mir gelingen, ganz bei mir zu sein und zentriert.
Das letzte ist natürlich sehr schwierig, wenn es z.B. um die Angst im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg geht. Selbstverständlich ist jede kriegerische Auseinandersetzung abzulehnen und die Aggressoren zu stoppen.
Für mein Wohlbefinden ist es aber wichtig, wenn ich die Realität im Moment so hinnehme wie sie ist ohne «wenn und Aber»!
Denn nur wenn ich ganz bei mir bin, bin ich am besten handlungsfähig. Im konkreten Fall des Ukrainekrieges kann ich überlegen, was in meiner Möglichkeit steht, jetzt zu tun: mich an Sammelaktionen zu beteiligen (Geld, Medikamente, Sachwerte…), Gesprächsrunden organisieren, Artikel zum Thema veröffentlichen, mit Freunden und Bekannten sprechen und sie sensibilisieren, Infos weiterzutragen (Schneeballeffekt), ev eine ehrenamtliche Tätigkeit in Flüchtlingsunterkünften anbieten, usw.
Medien und Angst
Medien sind sensationslüstern. Je mehr Spannung, je mehr Drama, desto besser verkaufen sie sich. Und das ist von den Medien so gewollt. Je mehr Angst in Umlauf gebracht werden kann, umso besser sind die Menschen zu steuern!
Wir sind aber nur Opfer der Medien, wenn wir dies zulassen! Wir können den Konsum von Medien so dosieren, dass es uns gut geht damit.
Tut es mir gut, 5x am Tag die Nachrichten zu schauen oder sollte ich höchstens 1x am Tag sie lediglich lesen ohne Bilder? Gewisse Spielregeln sind sicher sinnvoll, wie z.B. keine Nachrichten zu schauen, wenn ich anschliessend schlafen gehen möchte.
Auch können wir aussuchen, welche Medien wir konsumieren und welche wir ablehnen. Manchmal ist es spannend, Medien aus unterschiedlichen Ländern anzuschauen. So lernt man verschiedene Blickwinkel kennen.
Während der Coronapandemie hatte ich meinen Patienten abgeraten zu Corona die Tagespresse zu lesen, sondern lediglich 1x pro Woche die Infoseite des BAG (Bundesamt für Gesundheit). Das hatte völlig ausgereicht.
Es ist sehr wichtig, dass wir den Umgang mit Medien aktiv gestalten, weil dies nicht nur eine Auswirkung auf uns sondern auch auf das holographische Feld hat.
Angst: Bedeutung in der Gesellschaft und im holographischen Feld
Wir lassen uns von Glaubenssätzen steuern, auch die Gesellschaft.
Gedanken und Gefühle, die zum grossen Teil von unseren Glaubenssätzen gespeist werden, füttern das Energiefeld, das holographische Feld, in dem wir uns alle bewegen.
Es ist ein sehr grosser Unterschied, ob es Millionen Menschen gibt, die nun angsterfüllt auf die Ereignisse des Krieges schauen oder ob ein grosser Anteil dieser Menschen, bewusst sich zentriert und seine innere Balance, seinen inneren Frieden lebt (wie oben beschrieben).
Sind wir uns dessen bewusst, dass wir auf dieser Ebene eine grosse Kraft und eine grosse Macht entfalten können. Daher ist es wichtig, dass wir in unserem Umfeld im Austausch und Dialog sind.
Angst in der Entwicklung des Kindes
«Auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett»
Erich Kästner (1899 Dresden – 1974 München)
Jedes Kind lernt früher oder später Angst als grundlegendes Gefühl kennen. Alle Erwachsenen, die Kinder betreuen, sollten jede Angst der Kinder ernst nehmen, auch wenn das Kind Angst vor einem bösen Tier unter dem Bett hat. Gehen sie nicht gegen die Angst vor, bagatellisieren sie sie schon gar nicht.
Ich würde in solch einem Fall mir das Tier genau beschreiben lassen, welche Farbe es hat, wie es dich anschaut, ob es gross oder klein, dick oder dünn ist.. (im Dialog mit dem Kind sein), fragen, wie der Name des Tieres vielleicht sein könnte, oder ob das Tier etwas braucht, bei dem wir dem Tier helfen können.
So lernt das Kind, die Angst nicht abzulehnen sondern mit ihr in Kontakt zu treten, zu versuchen sie zu verstehen, Bilder entstehen zu lassen (Beschreibung des Tieres, was Angst macht, Namen finden, was das Tier braucht…). Je nach Alter des Kindes, erzählt ihm, wie ihr selbst mit Angst umgeht (Vorbild).
Angst ist eine starke archaische Kraft, die zum Leben gehört wie Liebe, Empathie, Wut, Hass. Wir sollten sie als solche Ernst nehmen und kultivieren. In unserer Gesellschaft sollte sie einen «würdigen» akzeptierten Platz einnehmen, wie andere o.g. Qualitäten auch.
Kinder sollten in einem solchen gesellschaftlichen Milieu heranwachsen und lernen, dass sie ihre archaischen Kräfte kultivieren und in ihr Leben integrieren können und sollen.
Dazu gehört das Erlernen und Akzeptieren, was mir guttut und was nicht mehr, auch der Umgang mit Medien.
So sagt Khalil Gibran
(1883 Osmanisches Reich, heute Libanon – 1931 New York, USA)
«Beherzt ist nicht, wer keine Angst kennt, beherzt ist, wer die Angst
kennt und sie überwindet.»
Michael Seefried, im März 22
Der Mensch, der nicht geachtet wird, bringt um
Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944, bei einem Aufklärungsflug abgestürzt, abgeschossen?)
Ukraine
In der Ukraine, also in Europa, herrscht Krieg.
Jede kriegerische Auseinandersetzung ist abzulehnen. Der Mensch ist in der Lage, noch so schwierige Konflikte anders zu lösen. Wer für den Frieden kämpft, wird nie Frieden schaffen. Nur wer den Frieden selbst lebt wie Mahatma Gandhi, wird Frieden in die Welt bringen.
Schauen wir genauer hin: 1991 haben sich 15 Staaten von der Gemeinschaft der Sowjetunion abgespalten. Das Sowjetreich zerfällt. Estland, Lettland, Litauen haben sich nach Europa orientiert und scheinen sich zunehmend zu stabilisieren. Alle anderen Staaten sind zunehmend instabil, es gibt regelmässig Blutvergiessen wie in Armenien und Aserbaidschan.
Bereits zur Wendezeit Anfang der 90 er Jahre, stellte Putin klar, dass er keine Osterweiterung der Nato und EU möchte. Gleichzeitig wird der Ukraine eine wichtige strategische konkurrierende Bedeutung zugesprochen, konkurrierend weil die USA und Russland gleichermassen diese Einschätzung verkündeten!!
2014 ruft Putin die Annexion der Krim aus (dies war nicht die erste in den letzten 200 Jahren) und im selben Jahr vollzieht sich ein Putsch in der Ukraine. Seitdem gibt es kriegerische Auseinandersetzungen mit vermutlich bis zu 20,000 Toten bis vor dem jetzigen Krieg, v.a. in den beiden ostukrainischen Gebieten.
Diese beiden Gebiete, Donezk und Lugansk spalten sich von der Ukraine ab und wollen unabhängige Staaten werden. Sie werden von prorussischen Separatisten unterstützt. Sie rufen ihre Staaten bereits 2017 als «Kleinrussland» aus. Dadurch ist die Gesinnung deutlich. Zudem macht Putin seit Jahren klar, dass Ukrainer und Russen ein Volk sind.
Die Nato siedelt eine grosse Militärtruppe von wenigstens 40,000 Soldaten fest in diesem Gebiet an. Putin lehnt weiterhin jegliche Osterweiterung der EU ab und meint damit natürlich die Ukraine im Besonderen.
Der Westen hat Putin nie wirklich ernst genommen und seine Massnahmen und sein Verhalten oftmals belächelt. Über Jahre wurde er sehr ausgegrenzt. Sogar Obama hat während seiner Regierungszeit (2016) versäumt, eine Beziehung zu Putin aufzubauen. Stattdessen hat er ihn genauso behandelt wie der Westen, belächelt und beleidigt.
Natürlich sind viele politischen Massnahmen von Putin nicht zu tolerieren, ihn deswegen komplett auszugrenzen, ist sicher kein kluger Schachzug. Zudem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Russland in seiner Entwicklung auf einer anderen Stufe steht, als die meisten europäischen Länder und Völker. Das gilt es zu berücksichtigen und zu würdigen, dass es so ist. Ein Demokratisierungsprozess muss in Russland erst noch sich vollziehen, wenn das Volk so weit ist. Ob Putin diesen Prozess begleiten will, ist offen. Im Moment können wir davon ausgehen, dass eine alleinige Machtposition ihm lieber ist als die Freiheit seines Volkes.
Daher wird Putin um jeden Preis verhindern, dass sich die Ukraine zu sehr in Richtung Europa orientiert. Das müssen wir ernst nehmen, und es schwelt sehr deutlich seit 8 Jahren. Die Sanktionen sind ihm sicher egal, sie werden ihn von seinem eingeschlagenen militärischen Weg nicht abbringen. Er wird jedoch empfindlich darauf reagieren, weil sie insbesondere sein Volk schwächen.
Putin als alleinigen bösen Übeltäter hinzustellen, ist falsch, auch unter Berücksichtigung der Geschichte. Wir erzwingen so eine Täter-Opfer-Beziehung, auf deren Boden eine friedliche Lösung nicht sichtbar werden wird.
Wichtiger wäre es, dass der Westen ein deutliches Signal sendet, z.B. wenn alle europäischen Regierungschefs zusammen nach Moskau reisen würden, um ein Gespräch zu fordern, was nachhaltige Lösungen im Konflikt aufzeigen soll, das wäre ein klares Signal.
Stattdessen gibt es Hasstiraden, Ausgrenzungen, Sanktionen und Waffenlieferungen (bisher Deutschland, Holland England, USA, andere werden folgen). Gespräche, Dialog, Putin in seiner Würde ernst nehmen, finden nicht statt.
Der 2019 gewählte Präsident Selenskyj hätte dieses Amt nicht erhalten, hätte er sich nach russischem Vorbild nicht von Oligarchen «helfen» lassen wie Kolomojskyi und anderen. Auch wenn er in den folgenden Jahren die Macht und Unantastbarkeit der Oligarchen schmälern wollte, so sind sie doch genauso wie in Russland präsent.
Regierungsgeschäfte ohne sie hinter verschlossenen Türen sind nicht denkbar. Oligarchen gab es schon zu Zeiten Platons, 400 vor Chr., es sind sehr reiche Menschen, die durch ihren Reichtum Macht für eigene Interessen ausüben.
Gehen wir aus dem Widerstand. Lösen wir uns von der Vorstellung, wenn Druck ausgeübt wird, muss ich einen Gegendruck schaffen. Wenn wir im inneren Frieden bleiben, in der inneren Balance, wenn Druck von aussen kommt, gibt es keinen Kampf. Ich gehe weder in den Angriff noch in die Abwehr, sondern bleibe in meiner Mitte, ohne
etwas zu wollen. Es geschehen Wunder, wenn man zu dieser inneren Einstellung findet. Der Aggressor findet keinen Gegner mehr und läuft ins Leere und verliert dadurch seine Balance.
Das altostslawische Wort «Ukraina» bedeutet Grenzland, Militärgrenze. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis auf sein Schicksal, oder lässt uns zumindest erahnen, dass wir uns nicht so massiv
einmischen dürfen, wie es der Westen derzeit tut. Ich wage zu behaupten, dass bei dieser Einmischung nicht nur die Interessen des ukrainischen Volkes im Fokus sind….
Die Ukraine war nicht immer russisch. Im 18. Jhdt. und ab 1919 gab es diese Bestrebungen.
Alle Demonstrationen oder Schreie und Forderungen nach Frieden werden verpuffen. Jetzt gilt es die «ranghöchsten» Menschen direkt und persönlich zu kontaktieren, die Regierungschefs der Länder,
inklusive Putin und Selenskyj.
Ich denke auch ein Putin ist für Begegnung, Beziehung, gesehen werden und Dialog offen.
Michael Seefried, 2.3.22
Ist die Welt im Chaos?
In den Industrienationen scheint die Welt äusserlich betrachtet in Ordnung gewesen zu sein. Schauen wir genauer hin, stellen wir fest: neben dem Reichtum zeichnet sich eine seelische Atemlosigkeit und Verarmung ab. Der Konsum an Psychopharmaka und Schlafmittel erreicht nie dagewesene Höhen. Leben wird immer mehr an materiellen Massstäben festgelegt. Daneben stellen wir fest: Naturzerstörung, Umweltverschmutzung, Ausbeutung der Tier- und Pflanzenwelt, Konsumstreben inkl. Ausbeutung der sog. Dritten Welt und damit deren krankmachende Abhängigkeit beherrschen den Alltag in den Industrienationen.
Kein Chaos? Doch – seit Jahrzehnten.
Astrologisches Weltgeschehen – das Jahr 2020
Astrologisch begann das Jahr mit der Konjunktion von Saturn und Pluto (12. Januar). Zwei machtvolle Planeten treten nah zusammen (Konjunktion). Man weiß, dass solch eine „geballte“ Ladung an Macht großartige Veränderungen im wahrsten Sinne des Wortes zu bewirken vermag, im schöpferischen wie im zerstörerischen Sinne.
Eine solche Konjunktion hat es zuletzt 1518 gegeben. Erinnern wir uns, dass 1517 Luther 95 Thesen in Wittenberg verfasst hat. In seiner Schrift klagte er den geschäftsmäßigen Handel und somit Missbrauch von Ablassbriefen an.
Ablass ist ein Relikt der katholischen Kirche und meint das Erlassen von Sündenstrafen. Richtig bekannt wurden diese Thesen, weil Freunde von Luther diese in Lateinisch verfassten 95 Thesen übersetzten und sie als Buch abdruckten. Auf diese Weise erfuhr es die Welt – eine historische Tat mit einer ebensolchen Wirkung. Die Reformation war eingeläutet, das Mittelalter definitiv beendet!
Das damalige Finanzsystem der „geistlichen und weltlichen Macht“ brach zusammen. Anthroposophisch gesprochen war die Ära der Bewusstseinsseele geboren; eine neue Zeitepoche begann. Global gesprochen zeigen sich die ersten Anzeichen vom Ende des Fischezeitalters und dem Beginn des Wassermannzeitalters. Der definitive Wechsel soll noch 500 Jahre andauern, aber der Beginn ist vollzogen und mit ihr eine nie dagewesene Bewusstseinsentwicklung des Menschen.
Ein neues Zeitalter – jetzt!
Das Wesen des Wassermannzeitalters besagt in groben Zügen Denken, Handeln und Fühlen in Polaritäten (gute-böse, gut-schlecht) zu überwinden, individuelle Vernetzung umzusetzen, Gutes für unsere Erde zu tun, individuelle und globale Verantwortung zu übernehmen, den Egoismus zu überwinden. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass auch die Religion als Konfession, als Dogma, als „Du musst“ überwunden werden sollte. Die 10 Gebote und anderes sind nicht mehr zeitgemäß; sie sollten nicht mehr von außen vorgegeben werden. Diese Werte sollten in jedem von uns entwickelt sein und leben. Vielleicht sind unter diesem Aspekt die Kriege, die wir derzeit haben, zu verstehen. Es sind überwiegend Religionskriege.
Corona März 2020
Bereits zum Zeitpunkt der Saturn-Pluto Konjunktion kündigte sich eine der größten Pandemien der Weltgeschichte seit dem 2. Weltkrieg an: die Covid-19 Pandemie oder kurz Corona-Pandemie. Ausgangspunkt scheint beim Jahreswechsel 19/20 eine Erkrankung mit einem Coronavirus in China zu sein. Rasant breitet sich das Virus weltweit aus. Ende März 20 zählen wir über 300,000 Infizierte weltweit und knapp 15,000 Tote, Ende Juni 20 ca. 10 Mio. Infizierte und knapp eine halbe Million Tote, im November 21 ca. 257 Mio. Infizierte und 5,1 Mio. Tote.
Über Statistiken lässt sich streiten, ob alle Verstorbenen ursächlich an Corona verstorben sind oder verstorben sind und zufällig auch coronapositiv waren, ob die Infizierten leichte oder schwere Verläufe hatten. Das ist nicht relevant!
Wir erkennen unschwer, dass die Welt sehr durcheinander geraten ist und das dieses Durcheinander trotz Impfkampagnen, Schutzmassnahmen nicht überwunden wurde oder eine solche Überwindung im Ansatz erkennbar wäre. Auch besteht die Neigung der Spaltung. Diese schaffen jedoch nicht die Politiker sondern die Menschen selbst, indem sie sich vehement und emotional positionieren und polarisieren. Wir leben im Moment einer Wende!
Die Welt hält den Atem an! Aber auch: die Welt fängt wieder zu Atmen an!
Im ersten Lockdown im März 2020 trat eine unglaubliche Ruhe ein, die Hektik des Alltags kam weltweit zum Stillstand. Die Natur und die Tiere eroberten sich in wenigen Wochen ihren Lebensraum zurück. Erinnert Euch! Wer hätte damals gedacht, dass die Natur so rasch zu reagieren in der Lage ist.
Was ist geschehen? Mit unglaublicher Wucht hat sich eine Viruserkrankung ausgebreitet, die insbesondere entkräftet, die Lunge betrifft und den Geruchssinn beeinträchtigt.
Politik und Schulmediziner setzen auf die Impfung, das haben sie immer schon getan, weil sie es nicht anders kennen und wissen wollen. Die Geschichte zeigt jedoch, dass es keine Krankheit gibt, die allein durch ein enormes Impfprogramm ausrottbar wäre. Das kennen wir von den Pocken, Tbc, Poliomyelitis, letztendlich auch die Grippe, wie wir jedes Jahr feststellen können. Andere Faktoren müssen hinzukommen, damit die Überwindung einer Krankheit gelingt – immer!
Aufschrei der Welt? Was will uns Corona sagen?
Es ist sehr interessant, dass Corona in erster Linie die Menschen entkräftet, ihnen also Lebensenergie nimmt. Dann ist fast immer die Lunge betroffen.
Die Lunge ist das Organ, das uns an die Erde bindet. Es ist das Inkarnationsorgan! Der erste Atemzug, meist als Schrei des Neugeborenen, verkündet diese Ankunft, der letzte kündet die Loslösung an.
Die Lunge und die Atmung gehören zu den rhythmischen Organen. Sie machen mit dem Herzen das Zentrum des Menschen aus und bilden das rhythmische System, dessen seelisches Äquivalent das Gefühl ist. Das rhythmische System ist Träger unseres Seelenlebens, und es ist Vermittler zwischen „oben“ und „unten“, zwischen Denken und Handeln, also zwischen dem Nerven-Sinnespol (seelische Qualität Denken) und dem Stoffwechsel-Gliedmaßen-System. (seelische Qualität Wille/Handeln).
Dann ist der Geruchssinn irritiert, der Sinn, der uns Riechen lässt und als seelische Qualität uns die Moral lehrt. Stellt Euch vor, warum beeinträchtigt Corona nicht den Sehsinn oder Gleichgewichtssinn?
Unsere Welt ist seit langem im Chaos, machen wir uns nichts vor: unser Lebensalltag in den Industrienationen hat mehr zerstörerische als gesunderhaltende Elemente, individuell, für die Gesellschaft und die Welt. Seit Jahrzehnten war es eine Frage der Zeit, wie lange das gutgehen mag. Durch Corona wurde das bestehende Chaos in einer unglaublichen Geschwindigkeit sichtbarer.
Wie können wir das Chaos schöpferisch überwinden?
Aus meiner Sicht ist jeder von uns aufgerufen, sich diesem wichtigen Moment mit verantwortlich zu fühlen.
Mein Eindruck ist, dass wir unser Leben kritisch hinterfragen sollen, sämtliche Bereiche überprüfen, welche verändert werden müssen, wie z.B. unser Konsumverhalten inkl. unsere enorme Reisefreudigkeit und die weltweiten Konsequenzen daraus, der C02 Ausstoss (mit Berücksichtigung des Fleischkonsums), die Monokultur in der Landwirtschaft, die Ausbeutung der Dritten Welt, die Neugestaltung einer modernen Pädagogik und Schulform, sowie einer modernen Therapie und Medizin.
Diese Bereiche sollten wir mithilfe der Qualitäten, die im neuen Wassermannzeitalter gelernt und gelebt werden sollen, „begutachtet“ werden, nämlich in die Klarheit und Authentizität zu kommen (ehrlich der Welt und sich selbst gegenüber sein), Polaritäten zu überwinden, Schuldzuweisungen mir selbst und anderen gegenüber zu beenden, stattdessen Gesten lesen und verstehen lernen und auch lernen „die Mutter Erde“ als Wesen wahrzunehmen, zu achten und zu würdigen.
Beispiele:
Tierhaltung: ist die Art und Weise der Tierhaltung für den Menschen und seine Gesundheit, für die Tiere und ihr Leben sowie für die Umwelt sinnvoll organisiert oder nicht?
Ca 10% des weltweiten C02 Ausstosses entstehen durch die Landwirtschaft.
Wir wissen, dass übermässiger Fleischkonsum eine gesundheitsgefährdende Wirkung hat.
Schule: Ist die heutige Schulform, deren Ursprünge mehr als 100 Jahre zurück liegen noch sinnvoll oder nicht? Sind Druck und Leistungsnachweise in der heute gelebten Form adäquate Mittel, um Kinder zu selbständigen, kreativen Menschen heranzubilden? Ist die Lehrerausbildung heute dafür geeignet?
Medizin: Ist der Konsum an Antibiotika beispielsweise sinnvoll organisiert oder nicht? Weil dies ein sehr problematisches Kapitel in der Medizin ist, wurde jeweils am 18. November jeden Jahres der sog. europäische Antbiotikatag organisiert; auf englisch ist er klarer formuliert „The European Antibiotic Awareness Day“.
Ist die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten auf dem neuesten Stand, auch unter dem Blickwinkel der „Wassermann“-Qualitäten?
Trägt die Macht der Pharmakonzerne dazu bei, dass die Gesundheit der Menschen stabiler und nachhaltiger wird?
Lern- und therapeutischer Prozess werden sich unter den Bedingungen unseres neuen Zeitalters grundlegend verändern müssen, so meine ich.
Was kann/soll der einzelne von uns tun?
„Ich habe nichts gegen das, was geschieht“ Krishnamurti
Dies ist wohl die wichtigste Voraussetzung!
Stellt Euch vor, dass die ganze Menschheit seit Monaten mit dem Thema Corona beschäftigt ist. Das gab es noch nie. Wichtig ist jetzt, Wesentliches herauszuarbeiten, das der Menschheitsentwicklung Rechnung trägt und nicht in Polaritäten abzudriften. Wir stecken in einer sehr wichtigen Evolutionsphase, die eine erhebliche Transformation unseres Bewusstseins zur Folge haben sollte. Diese wird Jahrzehnte andauern. Das Leben vor Februar 2020 wird es in dieser Form nicht mehr geben. Aber überall da, wo etwas zu Ende geht, darf und kann etwas Neues entstehen. Die Wassermannqualitäten können uns dabei helfen, Schritt für Schritt diese Transformation zu gehen.
Uns könnte helfen, wenn jeder von uns versucht, bei den Begegnungen des Alltags, innerlich inne zu halten und nicht sofort ein Gefühl dazu zu entwickeln, um wahrnehmen zu lernen, was mir dies jetzt sagen will (s. auch mein Artikel „Frieden“ in der Oktoberausgabe dieser Zeitschrift).
Wenn ich innerlich voreilig urteile, verschliesse ich mich vor einem Teil meiner Wahrnehmung.
Ich muss gestehen, dass mir diese Haltung beim Thema Coronaimpfungen bei Kindern sehr schwerfällt, mich also innerlich zurückzulehnen, um die Geste zu erfassen. Offenbar durchleben wir eine Lebenssituation, die alle, wirklich alle Menschen erfassen soll.
Daher sollten wir auch beim Thema Kinderimpfungen lernen, die Geste zu verstehen. Es werden noch einige Ereignisse auf uns einstürmen, die uns herausfordern werden. Da bin ich mir sicher.
Doch bleiben wir dran: wir haben es mit einem Virus zu tun, das unsere Lebensenergie schwächt, sehr oft unser Inkarnationsorgan die Lunge angreift und unsere Moral berührt. Dieses Virus ändert sich ständig, vor 1 Jahr waren überwiegend alte Menschen mit chronischen Krankheiten betroffen, jetzt sind die Verläufe bei gesunden Menschen zwischen 30-60 Jahren oftmals unerwartet heftig, so dass wir sagen können, Corona im November 21 ist eine andere Erkrankung als im Herbst 2020.
Nehmen wir dies Ernst.
Weiter sehen wir, dass die Impfungen nur befristet erfolgreich gegen Corona helfen. Es scheint unterschiedlich, wie lange der einzelne gegen eine Erkrankung geschützt ist. Bei den Genesenen scheint der Schutz länger anzuhalten.
Nehmen wir auch diese Eigenheit des Virusgebarens wahr und Ernst.
Für mich ist es hilfreich, wenn ich mich 1-2 x am Tag für 1-2 Minuten auf meine eigene Atmung konzentriere oder ihr immer wieder beiläufig gewahr bin. Das hilft mir, mein Bewusstsein zu schulen, immer wieder ganz präsent und auch mehr bei mir zu sein, so dass ich innerlich gelassener bleiben kann, auch wenn ich mit schwierigen Dingen konfrontiert werde.
Die Erkenntnis, dass wir seit vielen Jahrzehnten eigentlich im Chaos leben und sich dies jetzt durch Corona im Besonderen darstellt und uns förmlich „um die Ohren fliegt“, mag uns helfen, den Weg in das neue Zeitalter und somit der notwendigen Bewussteinsentwicklung und Transformation wirklich zu gehen.
Dazu wünsche ich allen Leserinnen und Lesern Mut und Optimismus, sich auf diese neuen Wege einzulassen.
Michael Seefried, im Dezember 2021
Frieden
Jeder muss seinen Frieden aus dem Inneren finden. Und damit der Frieden
echt ist, muss er von äusseren Umständen unbeeinflusst sein.
Mahatma Gandhi
Wenn ich an Frieden denke oder jemand mich darauf anspricht, dann reagiert etwas in mir, was ich «zwei Seelen ach in meiner Brust» nennen möchte.
Seit Menschengedenken gibt es Krieg und die Bemühung um Frieden. Haager Friedenskonferenz, Pariser Friedenskonferenz, Münchner Friedenskonferenz und viele mehr…
Religion und Frieden: für mich hört es sich wie ein Widerspruch an, wenn ich bedenke, wieviel Religionskriege es gegeben hat und heute noch gibt.
Wieviel Millionen Menschen wurden in religiösen Konflikten getötet, gefoltert, misshandelt.
Sobald jemand sich nicht an vorgegebene Dogmen, Regelsätze, Ideologien – und nicht nur religiösen Ursprungs – hält, ist sein Leben in Gefahr, auch heute noch in vielen Teilen der Erde. Machen wir uns klar, dass diese von Menschen ausgedacht sind und sich im Laufe der Jahrhunderte ändern können.
Wer entscheidet, was Wahrheit ist?
Wer masst sich an, dass mein Gegenüber meinen Dogmen, Regelsätzen folgen muss? Wo ist die Grenze?
Wo ist es gar erforderlich, Grenzen zum Wohl der Allgemeinheit einzufordern? Ein grosses Thema jetzt in der Coronapandemie und ihren Massnahmen.
Je mehr wir auf die Strasse gehen und für den Frieden demonstrieren, desto weniger wird er sich erfüllen. Vorträge und Seminare zum Thema Frieden zeigen keine nachhaltige Wirkung, wenn nicht jeder Mensch sein Inneres so beginnt zu gestalten, dass Friede gelebt werden kann, dass jede Zelle in mir diese Botschaft in sich trägt, dass ich so in meiner Mitte bin, dass mich nichts aus meiner inneren Mitte herauslocken kann.
Kampf gegen Drogen, Kriminalität, Gewalt gegen Frauen etc. ist genauso wirkungslos wie Kampf für den Frieden, Gerechtigkeit, Menschlichkeit….
Die Realität zeigt es uns. Im Kampf «gegen oder für…» bleiben wir im Aussen und in der Polarität, die wir aber nun überwinden sollen. Stattdessen sollten wir versuchen, etwas daneben zu stellen, dass im Inneren des Menschen sich etwas bewegen und entfalten kann.
In den Randbezirken von Lima wurden einige Hochhäuser errichtet mit schönen Wohnungen, mit dem Ziel Familien, die in den Slums lebten, dort leben zu lassen, in dem Versuch die Slums, in denen es regelmässig zu Gewalt, Kriminalität und Drogenmissbrauch kommt, zu verkleinern oder gar überflüssig werden zu lassen.
Was ist geschehen? Innerhalb weniger Jahre glichen diese Häuser den Slums. Warum? Es wurde im Aussen etwas versucht, was im Inneren nicht vorhanden war.
Wenn Frieden im Aussen gesucht wird, dann schlägt das immer fehl, solange es keinen Frieden im Inneren gibt. Es kann nur einen äußeren Frieden geben, wenn jeder seinen inneren Frieden gefunden hat.
Frieden ist demnach eine Frage der Haltung, der Präsenz und des Bewusstseins, mir selbst, meinen Mitmenschen und der Welt gegenüber. Daher kann ich Frieden nicht machen sondern muss ihn leben.
Ich kann mein Verhalten so gestalten, dass in mir Prozesse entstehen, die Raum geben für ein friedliches Miteinander. Dies ist auch in dramatischen Lebenssituationen möglich (z.B. Viktor Frankl, Mahatma Gandhi).
Im allgemeinen würde ich es so ausdrücken:
Durch einen Reiz entsteht eine Reaktion.
Zwischen Reiz <===> Reaktion entsteht ein Raum, den ich gestalten kann.
Dieser Raum kann meine Reaktion auf den Reiz beeinflussen. Wenn ich mich emotional treiben lasse, unterliege ich meinen Postulaten, denen meiner Familie und meines Kollektivs. Diese können lauten: «wenn mich jemand angreift oder beleidigt, wehre ich mich. Das darf nicht ungestraft bleiben».
Das sind Postulate, die den Boden für kriegerische Auseinandersetzungen bereiten. Eckhart Tolle nennt das in seinem Buch «Eine neue Erde» Krieg ist eine Denkart.
In den letzten Jahrhunderten waren wir es gewohnt, zu bewerten (gut-schlecht, richtig-falsch, lieb-böse), in Polaritäten zu denken, zu fühlen und zu handeln. Das sind Elemente des vergangenen Fischzeitalters, zu der auch der Egoismus, der Materialismus, Religionen mit ihren Dogmen und Regeln gehörten.
Nun sind wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in ein neues Zeitalter gerutscht, in das Wassermannzeitalter. Die Coronasituation hat diesen Entwicklungsprozess enorm beschleunigt. Die Welt vor Februar 2020 gibt es nicht mehr!
Wir sind nun aufgerufen, Klarheit und Präsenz zu entwickeln, Polaritäten hinter uns zu lassen und statt dessen zu lernen, die Gesten der Ereignisse zu erkennen und wahrzunehmen.
Daher..
Wenn ich nun beginne, selbst zu gestalten, präsent und gegenwärtig zu sein, kann ich selbst mit schwierigen Situationen anders umgehen.
Ich kann schlimme Ereignisse oder Worte, die mir entgegengeschleudert werden, erstmal als Geste nehmen, ohne sie zu bewerten. Ich kann dabei ganz bei mir bleiben, darf emotional reagieren, aber ich lenke die Emotion, die Emotion lenkt nicht (!) mich und kann mich fragen:
Warum sieht mein Gegenüber die Situation und mich so?
Was kann ich an meinem Verhalten ändern, dass mein Gegenüber mich anders sehen kann?
Habe ich einen Fehler gemacht? Dann räume ich dies ein und spreche es an.
Wichtig ist, dass ich die Äusserung meines Gegenübers ernst nehme, die Art und Weise wie mein Gegenüber sich äussert aber bei ihm/bei ihr lasse und nicht emotional bewerte.
Dadurch, dass ich mich bemühe, präsent und gegenwärtig zu sein, kann ein Raum entstehen, in dem es möglich ist, dass beide Gesprächspartner diesen Raum gestalten.
Kommt es zu einem emotionalen Schlagabtausch, entstehen rasch Beleidigungen und Zerwürfnisse, die keinen Raum für Begegnung, Beziehung bzw. Entwicklung mehr lassen.
Beispiel: Coronamassnahmen ablehnen, befürworten oder……?
Viele Menschen sind verunsichert hinsichtlich der Massnahmen während der Coronapandemie. Immer wieder werde ich angesprochen, ob ich nicht ein Zertifikat ausstellen könnte, keine Maske tragen zu müssen oder die Impfung zu umgehen. Mit anderen Worten werde ich gefragt, ob ich nicht für die betreffende Person lügen könnte und ein Dokument ausstellen, was nicht der Wahrheit entspricht.
In vielen Bereichen, auch in Schulen, sind zwei Lager entstanden, die einen «pro», die anderen «contra» der Massnahmen. Diese beiden Lager «bekriegen» sich, Freundschaften zerbrechen, Unmut steigert sich enorm, Klassengemeinschaften leiden, vor allem aber die Kinder.
Dies zeigt, dass das Ego der einzelnen Menschen durchschlägt. Die betroffenen Menschen gestalten den Raum zwischen Reiz und Reaktion nicht, sondern lassen ihren Emotionen und Postulaten ohne Führung ihres Ich freien Lauf. Dadurch kann der Egoismus mit seinen Ängsten sich voll und ganz etablieren.
Das ist Fischzeitalter pur, ein Treiben der Polaritäten (Massnahmen sind schlecht, keine Massnahmen gut) bis zum Ekzess, auch auf Kosten von anderen.
Ein solches Verhalten spaltet und bereitet den Boden für kriegerische Auseinandersetzungen. Dies gemischt mit einer zunehmenden Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Problemen und der Bürgerkrieg ist nicht weit.
Dabei ruft uns die jetzige Zeitepoche, zu der Corona gehört, zu Klarheit und Präsenz auf wie oben beschrieben. Wir können eine Haltung Corona und den Massnahmen gegenüber einnehmen, ohne in Polaritäten abzudriften.
Auch wenn es eine schwere Zeit ist, versuchen wir zu beherzigen, was die Zeit verlangt – sich dem Beginn des neuen Zeitalters zu stellen und auf die Herausforderungen, die es mit sich bringt, einzugehen. Wir alle sind aufgerufen.
Raum für Präsenz, Gegenwärtigkeit, Klarheit
Reiz <==============================================>Reaktion
Ohne Bewertung, bei mir bleiben
Gutes Gelingen und viel Glück.
Michael Seefried, im Oktober 2021
Macht macht Sinn oder sollte Macht nicht mehr zum Lebensalltag gehören?
Macht in der Eltern-Kind-Beziehung und in der Pädagogik
Ist Macht etwas Negatives? Ist Familienleben oder Schulleben ohne Macht möglich?
Wo Menschen leben, vollzieht sich Gemeinschaftsbildung, wie z.B. in einer Familie oder Klassengemeinschaft.
Macht ist etwas Negatives? Es ist interessant, dass viele von uns zuerst eine negative Vorstellung bekommen, wenn sie über Macht nachdenken. Das bedeutet, dass sie zuerst Vorstellungen von negativen Ereignissen im Zusammenhang mit Macht erleben wie Vorschriften machen, bevormundet oder kontrolliert werden gar Freiheitsberaubung, etc.
Was ist Macht?
Wenn man in gängigen Werken nachschlägt, findet man: „Macht bezeichnet die Fähigkeit einer Person oder Gruppe, auf das Denken und Verhalten einzelner Personen, sozialer Gruppen oder Bevölkerungsteile so einzuwirken, dass diese sich ihren Ansichten oder Wünschen unterordnen und entsprechend verhalten. Macht ist mehr oder weniger in allen Formen des menschlichen Zusammenlebens beteiligt und bedingt auf unterschiedliche Weise das Entstehen von Sozialstrukturen mit ausdifferenzierten, sozialen und strukturellen Einflusspotenzialen und gesellschaftlich zugeschriebenen Positionen“.
Das ist doch interessant. Die Definition als solches, lässt nichts Negatives vermuten. Im Gegenteil, es wird hier beschrieben, dass zum Entstehen von Sozialstrukturen Macht erforderlich ist.
Stellt sich also die Frage, wie Macht vielfach gelebt und erlebt wurde und wie Macht zukünftig als wertvolles Instrument einer Gemeinschaftsbildung strukturiert sein sollte?
Macht als Instrument von Gemeinschaftsbildung
Ich bin der Meinung, dass wir ohne Macht nicht auskommen, wollen wir eine fruchtbare, zukunftsweisende Gemeinschaftsbildung gestalten. Macht ist neutral wie Geld auch, und es kommt ganz auf uns Menschen an, was wir daraus machen.
Familie und Erziehung: Familienleben kann nur gelingen, wenn gewisse Spielregeln eingehalten werden, es eine gewisse Ordnung und Struktur gibt. Der Vater ist der Vater, die Mutter die Mutter, das erstgeborene Kind das erstgeborene Kind usw. Es ist sehr
wesentlich, dies einzuhalten, auch wenn die gelebte Familienstruktur sich völlig verändern sollte.
Hinzu kommt die notwendige Verabredung untereinander: wie werden wesentliche Aspekte des Familienalltags aufgeteilt, wie das notwendige Geld verdient, wie der Haushalt organisiert, die Betreuung der Kinder geregelt, übernehmen die Erziehung die Eltern gemeinsam? etc.
Eltern üben über ihre Kinder Macht aus. Ich würde sagen, das ist ein Naturgesetz. Das heisst, wenn es die Situation erfordert, müssen Vater oder Mutter sich eindeutig positionieren, wer das Sagen hat. Wenn Erwachsene da nicht liebevoll aber klar sind, wird es zu grossen Schwierigkeiten kommen, weil die Kinder oder Jugendlichen dann orientierungslos werden. Dann verschiebt sich die Verhältnismässigkeit: die Kinder wollen sich nichts mehr «bieten» lassen, wollen ihr eigenes «Ding machen» oftmals gegen den Willen der Eltern – es entsteht ein Machtspiel zwischen Eltern und ihren Kindern.
Schule: ich denke, es ähnlich zu betrachten wie in der Familie oder bei der Erziehung. Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an Steinerschulen spielen da eine besondere Rolle, weil sie in der Regel sechs Jahre eine Klasse führen. Dies ist oftmals ein Segen für die Kinder, kann allerdings auch einmal eine besondere Herausforderung für Kind und Lehrkraft bedeuten, wenn wenig Sympathie zwischen beiden mitschwingt.
Stellt sich die Frage: was braucht der Mensch? Wir wissen und das sagt uns schon unser ältester Sinn, den wir haben, unser Tastsinn, dass wir Grenzen brauchen und diese Grenzen uns helfen, eine Orientierung im Leben zu bekommen. Grenzen müssen wir selbst schaffen durch Verabredungen, die auch beinhalten sollten, wer das Einhalten dieser Grenzen einfordert. Das ist Macht!
In der Erziehung gibt es neben dem Ausüben von Macht eine wichtige weitere Qualität: die Vorbildfunktion. Je authentischer und klarer ich bin, desto weniger, muss ich im eigentlichen Sinn Macht ausüben. Es ergibt sich wie von selbst. Oftmals wollen Eltern mit ihren Kindern bestimmte Dinge diskutieren, sie also intellektuell ansprechen. Das kann ich mit Jugendlichen tun, nicht aber mit 3-4- oder 5 jährigen. Sie sollte ich gerade nicht intellektuell ansprechen. Vorleben ist viel wichtiger in der Regel. Ob das der Umgang Tagesrhythmen ist, mit Medien, das Maskentragen bei Corona oder anderes. Entscheidend ist vielfach nicht was die Eltern oder Lehrkräfte sagen, sondern was sie vorleben und denken!
Macht – meine Kindheitserfahrungen
Wenn wir in der eigenen Kindheit schlimme Erfahrungen sammeln mussten durch Gewalt und Machtmissbrauch und diese bisher nicht aufarbeiten konnten, werden automatisch unsere „Alarmglocken“ klingeln, wenn wir in eine Situation kommen, bei der im weitesten Sinne Macht eine Rolle spielt.
In einer solchen Stresssituation werden wir es schwer haben, adäquat zu reagieren und noch offen für Gestaltungsmöglichkeiten zu sein, egal, ob wir Macht ausüben oder erleiden. Wir werden eher starr und sind froh, wenn wir bald aus dieser Stresssituation herauskommen – oder wir machen es eben so, wie wir es von Kindheit an gelernt haben, mit Gewalt oder ohnmächtig und starr werden.
Liebe und Macht
Aus meiner Sicht hat jede Beziehung von Anfang an eine gewisse Machtdynamik, ganz gleich ob es eine Partnerschaft oder Freundschaft ist, zwischen Lehrperson und Kindern oder Eltern und ihren Kindern.. Wir schauen zu Beginn gerne weg, weil wir von dem «Zauber des Anfangs» eingenommen sind, wollen keine Stresssituation heraufbeschwören, meinem Gegenüber Zeit geben, etc.
Wir können dem vorbeugen, indem wir von Anfang an den Dialog pflegen, offen zueinander sind, ansprechen, bevor etwas eskaliert und zu Entwertungen und Respektlosigkeit führt, aktive Beziehungspflege tun.
„Liebe ist die stärkste Macht der Welt und doch ist sie die demütigste, die man sich vorstellen kann“, so Mahatma Gandhi. Das ist so, wenn wir sie uneigennützig zu leben versuchen, ohne Abhängigkeiten und Erwartungen. Wie schwer das ist, zeigt die Statistik: ca. 40% der Ehen wird wieder geschieden, da sind die Lebenspartnerschaften, ob eingetragen oder nicht, noch nicht dabei. Wir können also davon ausgehen, dass mehr Partnerschaften sich trennen als zusammenbleiben. Wenn ich dies als Geste auffasse, so kann ich sagen, dass diese Paare das Zusammenleben nicht weiter geschafft haben. Es muss also nicht unbedingt negativ sein!
Ein Amt, welches Macht verleiht, bedeutet eine grosse Herausforderung und Verantwortung, egal ob als Vater, Mutter, Lehrperson, in einem Vorstand oder Geschäftsführung. Diese Person sollte sich ganz zurücknehmen können und keinerlei persönliche Ambitionen hegen, sondern stets die Sache, um die es geht im Fokus haben. „Ich diene einer Aufgabe“, ist der zentrale Ansatz, Macht zukunftsweisend zu leben und zu gestalten, auch als Lehrkraft, Mutter oder Vater. Dabei sollte ich mir der Wichtigkeit meiner Vorbildfunktion bewusst sein.
Wir leben in einer Zeit der Transformation, in der wir lernen sollen, Polaritäten zu überwinden und Botschaften verstehen lernen. Wir müssen daher nicht mehr alles sofort be- bzw. verurteilen, ob etwas gut oder schlecht ist, richtig oder falsch, sondern erstmal erspüren, was es mir sagen will, was da gerade geschieht. Dies wird ein Moment grosser Ruhe sein, in dem ich ganz bei mir bin. Das ist genau die Voraussetzung, Macht zu leben, ohne das sie schadet.
Diese zukünftige Handlungsweise bedarf Fingerspitzengefühl, Achtsamkeit, Dialogfähigkeit und die Fähigkeit mein Gegenüber in seinem Sein zu sehen, sein Herz zu berühren. Auch sollte diese Person Klarheit leben und Prioritäten setzen können, und wenn es die Situation erfordert auch einmal „unerbittlich“ den Kurs verfolgen, der gerade erforderlich ist – stets im Sinne der Sache.
Bewusst vertiefe ich kein Kapitel über Machtmissbrauch, bzw. wie Macht nicht gelebt werden sollte. Hierzu gibt es genügend Beispiele in der Welt. Machtmissbrauch sollten wir unbedingt überwinden.
Fazit: Vorbild zu sein und Macht zu leben hilft uns eine zukunftsfähige, stabile, tragfähige Gemeinschaft zu bilden. In diesem Sinne ist Macht wie Gemeinschaftsbildung eine Kulturtat!
Literatur:
- Covey, Stephen: Die 7 Wege zur Effektivität
- Frankl, Victor: Trotzdem Ja zu Leben sagen
- Glöckler, Michaela: Macht in der zwischenmenschlichen Beziehung
- Seefried, Michael: „Kommt ein Kind zum Arzt, Dem Leben mit Zuversicht begegnen“,
- Gemeinschaften heute – eine Kulturtat? S. 86 ff).
Michael Seefried, im August 2021
Hilfe, meine Eltern trennen sich!
Eine Betrachtung aus Sicht des Kindes
Liebe Eltern!
Sie haben es nicht geschafft, Ihre Beziehung aufrechtzuerhalten bzw. zu retten. Zu viele Ereignisse sind vorgefallen, die es Ihnen unmöglich erscheinen lassen, dass es gemeinsam weiter gehen kann – aus Ihrer Sicht. Die Sicht des Partners ist meist eine andere. Aus meiner Erfahrung hat es sich gezeigt, dass es in einer solchen Situation meist sehr hilfreich ist, sich begleiten zu lassen, von einem Beistand oder Coach, zum dem Sie beide Vertrauen haben können.
Nun Sie als Eltern trennen sich. Doch Sie werden immer Eltern bleiben und Ihr Kind wird Sie immer als Papa und Mama lieben. Daher bitte ich Sie inständig um folgendes:
Schimpfen Sie nicht über den anderen Elternteil!
Sprechen Sie am besten gemeinsam mit Ihrem Kind – seinem Alter gemäss.
Sie sind verletzt, enttäuscht und sehr traurig – lassen Sie dies zu anstatt den resultierenden Frust auf unschöne Weise Luft zu lassen. Die Mütter erfinden oft Verhaltensmuster, dem Vater den Umgang mit dem Kind zu minimieren (hat Fieber, „will“ nicht etc…), die Väter drehen gerne den „Geldhahn“ zu oder lassen sich anderes einfallen.
Diese Beispiele kommen leider in weit mehr als der Hälfte der Fälle vor. Sie ärgern damit vielleicht den Partner, aber was Ihnen auf jeden Fall gelingt, sie verletzen zutiefst ihr Kind!
Denn ihr Kind ist Ihnen beiden loyal gegenüber aufgrund der Tatsache, dass sie seine Mutter und sein Vater sind, und das ist gut und richtig so!
Durch die Art der Trennung können Sie beim Kind einen Loyalitätskonflikt erzeugen oder vermeiden. Sie haben es gemeinsam als Eltern in der Hand.
Gelingt es Ihnen, eine möglichst wenig aufreibende Trennung zu gestalten, können Sie einen Loyalitätskonflikt bei Ihrem Kind vermeiden. Ich kenne Trennungen, die sehr gut vollzogen wurden, Eltern offen miteinander kommunizieren können, der Umgang offen geregelt ist, wichtige Entscheidungen für das Kind gemeinsam getroffen werden und selbst da, ist der immens grosse Einschnitt in das Leben des Kindes deutlich zu wahrzunehmen.
Gelingt Ihnen das nicht und entwickelt ihr Kind einen Loyalitätskonflikt einem oder beiden Eltern gegenüber, so leidet es sicher viel mehr und viel länger. Zudem besteht die Gefahr, dass es später im Leben Beziehungsschwierigkeiten haben wird.
Was ist ein Loyalitätskonflikt?
Kinder lieben Mama und Papa. Wenn wir ein Kind betrachten, erkennen wir stets Merkmale von Mama und Papa. Und so ist es auch. Das Kind erkennt sich in Mama und Papa wieder. Umgekehrt ist es, wenn Mama den Papa ablehnt und ständig über ihn schimpft, fühlt das Kind einen Teil von sich selbst abgelehnt! Dies gilt umgekehrt natürlich genauso.
Diesen Konflikt, den das Kind in sich – meist unbewusst – erlebt, führt zu einem Loyalitätskonflikt. Das Kind darf die selbstverständliche, vertrauensvolle uneingeschränkte tiefe Liebe zu seinen Eltern nicht leben. Es ist an Regeln gebunden. Manchmal darf es die Liebe zum Papa nicht vor der Mama zeigen oder viele andere ähnliche Beispiele. Dies ist eine schreckliche Erfahrung für das Kind, die meines Erachtens an Missbrauch grenzt. Das Kind wird in seinem tiefsten Sein erschüttert.
Natürlich wird es diesen Zusammenhang so gar nicht erkennen – dennoch trifft er zu.
Daher bitte ich Sie als Eltern, zu bedenken: sie haben in ihrer Familie zwei Gemeinschaften gegründet – die Partnerschaft und die Familie. Die Partnerschaft können Sie lösen, die familiäre Bande nicht. Auch wenn Papa Mama ausgrenzt oder umgekehrt und ein Elternteil das Kind gar nicht mehr sehen kann, Mama bleibt Mama und Papa Papa. Und die Kinder werden immer eine tiefe Sehnsucht nach beiden haben – zurecht. Bitte ermöglichen Sie ihren Kindern, den regelmässigen Kontakt zu beiden Elternteilen und belasten sie sie nicht mit partnerschaftlichen Themen, so massiv diese auch sein mögen.
Versuchen Sie sich zu vergegenwärtigen: die Partnerschaft ist Ihnen als Paar und Eltern nicht geglückt. Hierzu gibt es keine Schuld! Das bedeutet, entscheiden Sie sich, Schuldzuweisungen zu beenden – denn es ist ein riesiger unendlicher Rattenschwanz, der niemals zu etwas führt als zu unendlichem Streit. Versuchen Sie zu verstehen, warum es nicht geklappt hat ohne „du bist Schuld“ und machen dann einen Strich und respektieren, das es ist wie es ist.
Fahren Sie mit Schuldzuweisungen fort, verlängern Sie auch die Beziehung, weil sie sich nicht vollständig voneinander lösen als Paar. Dies hat auch die Konsequenz, dass Sie nicht ganz frei für eine neue Beziehung werden. Dies belastet eine neue Beziehung, weil Sie sie unfrei beginnen.
In der Regel benötigen Paare in einer solchen Situation zumindest vorübergehend eine professionelle Begleitung.
Medienkonsum und Kindesentwicklung
Medien sind ein fester Bestandteil unserer Welt. Die Nutzung von Medien kann unseren Alltag, insbesondere den beruflichen, enorm erleichtern.
Andererseits haben Medien ein starkes Suchtpotential für jede Altersgruppe. Kinder brauchen eigentlich keine Medien, um gesund heranzuwachsen. Im Gegenteil wir wissen, und es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass Medienkonsum, insbesondere, wenn er regelmässig und übermässig vollzogen wird, die Kindesentwicklung beeinträchtigen oder gesundheitsschädigend sein kann.
Schauen wir uns das Wesen des Kindes an:
Kinder sind nachahmende Wesen, und sie sind Bewegungswesen. Sie nehmen die Welt wie sie ist und wie sie von den Eltern bzw. den Erwachsenen in ihrem Umfeld vorgelebt wird. So lernen sie verstehen, wie die Welt funktioniert. Sie erfahren sie. Kinder leben überwiegend in einer Bilderwelt, sie sind schöpferische, kreative, phantasievolle Wesen, die über Bilder ihre Welt erfahren und so verstehen lernen. Unter diesem Aspekt ist es fraglich, wenn man Kinder immer alles erklären möchte, sie also intellektuell anspricht.
Nehmen wir die Coronapandemie und die Maskenpflicht. Kinder erleben, dass Erwachsene in bestimmten Situationen Masken tragen, wie z.B. im öffentlichen Verkehr. Wenn die Erwachsenen dies so tun, haben die Kinder kein Problem und stellen es nicht in Frage. Und dies werden die Kinder auch dann nachahmen, wenn die Eltern verunsichert sind, ob Maskentragen sinnvoll bzw. wirkungsvoll ist oder nicht. Entscheidend ist, dass die Eltern die Masken tragen. Stellen allerdings die Erwachsenen in der unmittelbaren Umgebung des Kindes das Maskentragen in Frage oder weigern sich, sind die Kinder verunsichert.
Bewegung: Fast alle Spiele der kleineren Kinder sind Bewegungsspiele. Kinder bewegen sich gerne und viel. Über die Bewegung bilden die Kinder ihren Willen aus. Über kreative und phantasievolle Tätigkeiten wie Malen, Handwerkliches aber auch Musik und Theater füttern sie gewissermaßen ihre Seele, ihr Gefühlsleben. Dies zusammen bildet das Fundament, dass Kinder auch intellektuell lernen. Die emotionale und soziale Entwicklung bildet die Grundlage für Lernen.
Medien: Gamen oder einen Film schauen hat folgende Effekte.
Die Kinder werden bewegungslos, weil sie gebannt auf den Bildschirm starren, was wider ihre Natur ist. Der Sehvorgang ist ein aktiver Prozess. In Sekundenschnelle tasten wir den Gegenstand, den wir betrachten, von allen Seiten ab. Beobachten sie mal einen Menschen, der ein Gemälde betrachtet. Dann können sie den Sehvorgang unmittelbar wahrnehmen. Kinder müssen dies im Laufe von Jahren lernen. Der aktive Sehvorgang
wird durch Filme oder Gamen unterbrochen, weil die Bilderabfolge (bei Filmen 25-50 Bilder/Sekunde), so rasch abläuft, dass der aktive Sehvorgang ausgeschaltet wird. Auf diese Weise kann die Entwicklung des aktiven Sehvorgangs gestört werden.
Die Erlebnisse und Erfahrungen, die Kinder beim Spielen erfahren, werden im Umgang mit Medien nicht gemacht. Durch die Neurobiologie wissen wir, dass durchlaufene Erfahrungen einen Einfluss auf die Ausgestaltung unseres Gehirnes machen. Erfahrungen plastizieren also förmlich unser Gehirn.
Es geht nicht darum, den Medienkonsum bei Kindern abzulehnen. Es ist mir jedoch wichtig, dass Sie um diese Tatsachen wissen und die Intensität des Konsums anpassen.
Kinder und Jugendlichen können wir bei diesem Thema nicht alleine zu lassen. Treffen sie gemeinsam mit den Kindern Verabredungen, vielleicht auch schriftlich. So entgehen sie langen, aufreibenden Diskussionen. Fordern sie diese Verabredungen ein. Ich bin sicher, dass ihre Kinder in einigen Jahren ihnen für diese klare Haltung und Begleitung dankbar sein werden.
Michael Seefried, Juli 20
Fieber ist ein Symptom.
Fieber allein sagt uns nichts über die Ursache. Es kann ein einfacher Infekt sein, eine beginnende Lungenentzündung oder auch Durstfieber, insbesondere bei den ganz kleinen Kindern. Auch seelische Krisen oder Schocks können zu Fieber führen. Fieber hat grundsätzlich eine stärkende Wirkung. Es ist immer ein Zeichen, dass der Alltag anders, fürsorglicher und achtsamer gelebt werden sollte. Ein fieberndes Kind bedarf der aufmerksamen Begleitung. Es ist nicht so wesentlich, wie hoch die Körpertemperatur gestiegen ist sondern wie das Kind mit dem Fieber umgeht.
Von Fieber spricht man ab einer Erhöhung der Körpertemperatur auf 38 Grad oder höher. Kinder entwickeln in der Regel rascher Fieber als Erwachsene. Die Körpertemperatur wird über das Blut reguliert und diese wiederum über den Hypothalamus, einer Region im Gehirn. Dort wird auch die individuelle Basistemperatur festgelegt. Das bedeutet, sowohl die Körpertemperatur, das Fieber als auch die Geschwindigkeit der Entstehung von Fieber und seiner Höhe sind sehr individuell. Die Körpertemperatur kann von Mensch zu Mensch variieren und hängt u.a. von seinem Temperament ab. So weist ein Choleriker eine höhere Basistemperatur und höhere Temperaturschwankungen auf als ein Phlegmatiker. Unsere Körpertemperatur unterliegt auch Tages- und Monatsschwankungen. So haben wir unser Minimum gegen 5 Uhr früh und unser Maximum gegen 17 Uhr. Bei Frauen steigt die Körpertemperatur nach dem Eisprung um ca ein halbes Grad bis ein Grad an.
Bei Neugeborenen und in den ersten zwölf Lebensmonaten sollte Fieber immer Grund zur aufmerksamen Beobachtung und fachlichen Kontaktaufnahme Anlass geben. Ein möglicher Grund könnte sein, dass das Kind zu wenig trinkt (Durstfieber). Dieses verschwindet dann spontan, wenn es genügend zu trinken bekommt. Allerdings gibt es auch schwerwiegendere Ursachen.
Jedes Kind wird auf seine ganz eigene Weise Fieber entwickeln. Das eine Kind quängelt ein bis zwei Tage, bis es dann endlich Fieber von 38.5 Grad Celsius entwickelt und sich damit sehr schwer tut; das andere Kind entwickelt innerhalb von ein paar Stunden 40 Fieber, ist zwar etwas schlapp aber spielt noch. Fragt man Eltern, so kennen sie diese individuellen Eigenheiten der Fieberentwicklung ihrer Kinder.
Fieber ist ein Symptom.
Fieber zeigt uns an, dass der Körper begonnen hat, sich gegen etwas zu wehren. Doch können wir allein aufgrund des Fiebers nicht sagen, warum das Kind Fieber entwickelt hat. Ursachen können sein ein banaler Infekt, das Zahnen, eine Mittelohrentzündung oder auch der Beginn einer Lungen- oder Hirnhautentzündung.
Ob Zahnen zu Fieber führen kann, ist auch unter den Ärzten umstritten. Aus meiner Sicht passt Fieber zum Zahnen dazu. Beim Zahnen haben wir eine lokale Entzündung des Zahnfleisches, die den Körper zu einer fieberhaften Reaktion veranlassen kann.
Auch seelische Ursachen können zu Fieber führen. Wenn ein Kind sich sehr erschrocken hat oder auch einen heftigen Streit der Eltern miterleben musste, kann es in der Folge eine fieberhafte Reaktion entwickeln.
Über viele Jahre wurde Fieber rigoros mit Paracetamol (Dafalgan, ben-u-ron) bekämpft. Das ist in vielen Ländern wieder verlassen worden.
Fieber zulassen macht Sinn
Fieber zeigt an, dass der Körper sich gegen etwas wehrt. Es ist als solche eine gesunde Reaktion. Allerdings bedarf ein fieberndes Kind der aufmerksamen Begleitung und Pflege. Für den Moment scheint die Begleitung fiebernder Kinder zeitaufwendig oder gar lästig zu sein. Jedoch können wir oftmals sehen, dass Kinder gestärkt aus einer fieberhaften Erkrankung hervorgehen. Auch können sie gewachsen sein, ein wenig „erwachsener“ oder individueller geworden, d.h. sie haben etwas von ihrem Kindsein abgestreift zugunsten einer ihnen gemässen individuellen Entwicklung.
Ich erlebe in meiner Praxis, dass Kinder, die bei Infekten leicht Fieber entwickeln können, insgesamt stabiler sind und robuster erscheinen als Kinder, die kaum oder gar nicht Fieber bekommen.
Blut ist ein besonderer Saft wie Rudolf Steiner bereits treffend formulierte. Im Blut zeigt sich unser Individuellstes. Niemand von uns hat die identische Blutgruppe wie jemand anders. Mittels Blutspuren können Kriminalbeamte einen Menschen identifizieren. Im Blut ist unser Ich zu Hause. Jedes Fieber hat somit einen Einfluss auf unser Ich oder besser die Ich-Entwicklung des Kindes. Dies bestätigen viele Eltern, die fiebernde Kinder begleiten.
Daher ist es sinnvoll, dass Fieber heute nicht mehr so rigoros gesenkt wird, damit die Kinder lernen, adäquat mit ihrem Fieber umzugehen. Damit meine ich, dass die Eltern, die ihre fiebernden Kinder begleiten, das Gefühl bekommen, dass ihre Kinder mit ihrem Fieber zurecht kommen.
Untersuchungen bei an Krebs erkrankten Patienten haben ergeben, dass diese auffallend wenig Fieber im Kindesalter entwickelt haben. Offenbar scheint es für die Entwicklung des Immunsystem eine grosse Bedeutung zu haben, ob im Kindesalter wiederholt fieberhafte Infekte durchgemacht wurden.
Vorgehen bei Fieber
Ihr Kind bekommt plötzlich Fieber. Überlegen Sie in diesem Moment, was Sie tun. Das Wichtigste ist jetzt, gut auf das Kind zu schauen und es zu beobachten. Wie geht es Ihrem Kind? Trinkt es noch ausreichend? Das fiebernde Kind muss oder sollte nicht oder nur wenig essen, da es ja etwas anderes verdauen muss .
Ist es jetzt von grosser Bedeutung zu wissen, ob das Kind 38,5 oder 39,5 Grad hat?
Messen Sie während einer fieberhaften Erkrankung nur dann die Körpertemperatur, wenn dies eine Konsequenz mit sich bringen würde. In den meisten Fällen können Sie die Indikation für ein Zäpfchen aufgrund des Allgemeinzustandes stellen, wenn z.B. ihr Kind wegen Fieber nachts nicht zur Ruhe kommt. Da ist es dann unerheblich, wie hoch die Körpertemperatur ist. In der Regel brauchen Sie nicht öfter als 2-3x pro Tag die Temperatur ihres Kindes messen. Häufigeres Messen hat meist zur Folge, dass die Eltern nervös werden; dies überträgt sich dann wiederum auf ihr Kind.
Erholungsphase – die Rekonvaleszenz
Wenn ein Kind mit einem fieberhaften Infekt mehrere Tage erkrankt und wieder gesund wird, hat es enorm viel geleistet. Fieberhafte Erkrankungen sind für Kinder anstrengend und kräftezehrend, und sie sind gesund. Kinder brauchen sie für eine gesunde stabile Entwicklung. Wie wir gesehen haben, wirkt sich ein fieberhafter Infekt immer auf die Ich-Entwicklung des Kindes aus. Meist haben Kinder während einer solchen Erkrankung keinen oder wenig Hunger. Das ist auch gut und richtig so, haben sie doch etwas anderes zu verdauen. „Das Kind muss doch essen“, ist ein Postulat, was sehr tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Bitte lösen Sie sich davon und horchen auf den Instinkt ihres Kindes. Leichte Kost und jeweils kleine Portionen sind die beste „kulinarische Begleitung“, solange die Kinder das Krankenlager hüten. Aber bleiben Sie auch innerlich ganz ruhig, wenn ihr Kind jegliches Essen ablehnt. Es kommt sicher die Phase, in der die Kinder eventuelle Gewichtsverluste aufholen.
Auch wenn beide Eltern arbeiten und eine Erkrankung des Kindes eine familiäre Stresssituation nach sich zieht, so möchte ich für die Kinder sprechen und sehr darum bitten, die Rekonvaleszenzphase als ebenso wichtige Phase wie die Erkrankung selbst Ernst zu nehmen. Kinder sollten wenigstens zwei Tage fieberfrei sein und mindestens einen Tag wieder ganz gesund zu Hause rumspringen, bevor sie wieder in den Kindergarten oder in die Schule gehen.
Dr. med. Michael J. Seefried
Familiensystemik und Rückführungen
Familiensystemische Realität– ihre Achtung als heilsame Kraft
Wir haben das Bedürfnis immer individueller durchs Leben zu gehen; dennoch sind wir Lebensgesetzen unterworfen. So wie auf der körperlichen Ebene lebenswichtige Körperprozesse wie Atmung und Herztätigkeit funktionieren müssen, so sollten für das seelische Wohlbefinden gewisse Lebensgesetze funktionieren, um eine ungestörte Entwicklung zu garantieren. Diese sind teilweise familiensystemischen Ursprungs. Die wichtigsten sind die Bindung, der Ausgleich und die Ordnung. In den ersten Lebensjahren ist neben der uneingeschränkten Liebe die Bindung die wichtigste Qualität für die Entwicklung eines stabilen Fundamentes für das weitere Leben des Kindes. Wird dies erschüttert, beeinflusst dies das weitere Leben des Kindes.
Familien sind Gemeinschaften. Unter familiensystemischen Gesichtspunkten nennen wir sie Systeme. Systeme zeichnen sich durch eine eigene Charakteristik aus, die wir als Energie, Raum, Aura, Ätherleib oder „Familienäther“ wahrnehmen. Kommen wir erstmalig in eine neue Familie, spüren wir dies sofort. Es ist eben die andere „Familien-Aura“, die uns umgibt. Es gibt Regeln, Überzeugungen, Tabus, die anders sind, als wir sie kennen.
Jedes System unterliegt gewissen Gesetzen, so auch die Familie. Diese sind nicht moralisch im herkömmlichen Sinne zu beurteilen sondern als familiensystemische Tatsachen zu begreifen. So sprechen wir im familiensystemischen Zusammenhang weniger von Schuld, weil sie zu sehr moralischen Charakter hat. Wir verwenden eher das Wort Verstrickung, um aufzuzeigen, dass es einen Konflikt gibt, aber dabei moralisch neutral zu bleiben.
Die wichtigsten Gesetzmässigkeiten sind:
Die Bindung – die stärkste Kraft, Urliebe
Die Bindung ist das wichtigste Element der ersten Lebensjahre. Sie wird vom Kind als Glück und Liebe erlebt, egal wie gut oder schlecht man sich um das Kind kümmert. Das Kind „weiss“, dass es dazugehört (Urliebe). Die Bindung geht so tief, dass es sogar bereit wäre, sein Glück und sein Leben der Bindung zuliebe zu opfern.
Der Ausgleich – Geben und Nehmen
Dies ist ein Punkt, der nicht unterschätzt werden sollte. Es ist das Bedürfnis nach einem „Ausgleich von Gerechtigkeit“. Das bedeutet, dass in einer Partnerschaft das Geben und Nehmen zum einen abgesprochen sein sollte, zum anderen so ausgeglichen, dass es für beide stimmt. Wenn ein Paar eine Familie gründet, ist es wichtig, dass die Eltern sich daraufhin verständigen, wer sich wann um das Kind kümmert und wer hauptsächlich die finanzielle Seite abdeckt. Wenn die Frau z.B. dem Mann die Berufsausbildung finanziert, sollte das Paar sich verständigen, wie hierzu der Ausgleich geschaffen wird.
Wenn ein 65-jähriger Mann, eine knapp 30-jährige Frau zur Frau nimmt, haben wir systemisch die Tatsache, dass der Mann einen grossen Teil seines Lebens schon hinter sich hat, die Frau aber noch vor sich – eine grosse Gefahr, dass durch dieses Ungleichgewicht, der wichtige Ausgleich in der Paarbeziehung nicht gelingt.
Ich sage nicht, dass solche Paarbeziehungen nicht gelingen. Man sollte sich aber der Dynamik bewusst sein.
Zwischen Eltern und Kindern ist ein Ausgleich nicht möglich. Familiensystemisch gesehen bleiben die Kinder ihren Eltern gegenüber immer in der „Schuld“. Das ist natürlich nicht moralisch zu bewerten. Daher ist es wichtig, dass sich die Kinder, wenn sie gross sind, von ihren Eltern lösen. Hier kann ein Ausgleich auf anderer Ebene stattfinden: das, was die Kinder von ihren Eltern empfangen durften, weiterzugeben, indem sie selber Kinder bekommen oder sich in intensiver Weise einer Sache oder einem Projekt widmen.
Die Ordnung – Regeln im Zusammenleben
Darunter verstehen wir Regeln, die das Zusammenleben in festen Bahnen lenken, wie gemeinsame Normen und Rituale, Überzeugungen, Tabus, die für alle verbindlich sind. Z.B. werden die Jahresfeste besonders gefeiert oder es gibt bestimmte Angewohnheiten an den Wochenenden, oder es wird zum Essen gebetet und gibt feste Essenzeiten usw. . So wird aus Beziehungen ein System mit Ordnung und Struktur, eine besondere Herausforderung für neue Beziehungen.
Das Gewissen – die innere Stimme
Das Gewissen ist die innere Stimme eines Systems. Es ist der Gleichgewichtssinn in Beziehungen. Es „wacht“ gewissermassen über die Bindung, den Ausgleich und die Ordnung, d.h. es wacht, was dem Dazugehörigkeitsgefühl fördert oder schadet. So dienen das gute und das schlechte Gewissen dem Ziel, unsere Bindung an unsere Wurzeln zu sichern, mithilfe des Ausgleichs und der Ordnung.
Bedeutung für die Familie
Wir alle werden in unsere Familie hinein geboren. Wir haben Eltern, Grosseltern, Geschwister, völlig gleichgültig, ob wir in dieser Gemeinschaft heranwachsen oder nicht. Für die familiensystemische Dynamik ist es unerheblich, ob die Eltern sich getrennt haben oder wir die Eltern gar nicht kennen.
Früher oder später wird jeder die enorme Kraft, die von unserer Herkunftsfamilie ausgeht, spüren. Kinder, die ihre Eltern nie kennengelernt haben, auch wenn ihnen dies verschwiegen wurde, werden irgendwann eine Sehnsucht in sich entdecken. Diese ist in uns sehr tief und fest verankert. Es ist die intensive Bindung an unseren Ursprung, die wir unbewusst und irgendwann immer bewusster wahrnehmen, auch wenn diese Bindung nie leben durfte. Daher hat jeder von uns das Recht, seine leiblichen Eltern kennenzulernen bzw. möglichst viel über sie zu erfahren.
Alle Menschen, die ich mit solch grundlegenden Fragestellungen begleiten durfte, haben es als wohltuende befreiende und für ihr Leben selbstverständliche Haltung erfahren, ihren leiblichen Eltern einen besonderen Platz in ihrem Herzen zu geben, auch wenn diese sie vernachlässigt, missbraucht haben oder kriminell geworden sind. In einigen Fällen fiel es den Menschen wie Schuppen von den Augen, wenn ich dieses Thema angesprochen habe. Denn sie spürten über Jahre eine grosse Sehnsucht oder Leere, die sie sich nicht erklären konnten. Sie erlebten, dass sie grosse Schwierigkeiten hatten, sich in eine Beziehung einzulassen oder hatten Suchtprobleme.
Es scheint für unser Leben von existentieller Bedeutung zu sein, unseren Ursprüngen voll und ganz zuzustimmen, in dem Sinn, dass wir ganz zustimmen, dass unsere Eltern unsere Eltern sind.
Für Kinder, die bei Pflege- oder Adoptiveltern aufgewachsen sind, ist es wichtig, diese beiden Realitäten zuzulassen und zu akzeptieren. Adoptiveltern können nicht die leiblichen Eltern sein. Sie leisten Hervorragendes und geben diesen Kindern ein Zuhause. Sie sind aber die Adoptiveltern, nicht die Eltern und stehen familiensystemisch gesehen am 2. Platz . Auch das ist nicht zu bewerten; der 1. Platz ist nicht besser als der 2. Nur unter dieser Berücksichtigung können Adoptivkinder am besten heranwachsen und die leiblichen Eltern in ihrer Würde bleiben. Es muss gar keine persönliche Beziehung zu ihnen existieren – relevant ist der Umgang. Es ist daher wichtig, dass die Adoptiveltern im Alltag den leiblichen Eltern ihres anvertrauten Kindes einen Platz einräumen.
Unsere Seele „weiss“ sowieso um diese Zusammenhänge, das bedeutet, dass wir in unserem Unterbewusstsein um die Konflikte oder Verstrickungen wissen. Durch eine klassische Familienaufstellung mit Stellvertretern oder mit Figuren kann man die Dynamik, die in der Ursprungsfamilie herrscht, darstellen.
Wenn wir auf diese Weise Verstrickungen aufdecken, können wir versuchen, wieder eine familiensystemische Ordnung herzustellen. Mit Verstrickung ist hier gemeint, dass das System an einer oder mehreren Stellen aus dem Gleichgewicht geraten ist, weil z.B. ein Familienangehöriger durch eine schlimme Tat, die er begangen hat, aus dem System geworfen wurde. Oder bei einer Trennung, wurde der Vater aus dem System gejagt und im Alltag wird nicht mehr oder nur schlecht über ihn gesprochen.
Dieses Ungleichgewicht im Familiensystem wirkt sich auf alle Mitglieder dieses Systems aus. Oftmals fühlen sich Kinder oder Enkel unbewusst dafür verantwortlich, dieses System wieder in das Gleichgewicht zu bringen, d.h. den Ausgestossenen wieder ins System zu holen.
Die wichtigsten Elemente in der familiensystemischen Arbeit sind wohl, dass uns diese Zusammenhänge, denen jedes System ausgesetzt ist, bewusst werden. Die Konsequenz ist, dass jedes Familienmitglied unabhängig jeglicher Streitereien oder schwerer Vergehen an seinem Platz, der ihm zusteht, bleibt. So kann diese Person in seiner Würde bleiben und das System Familie im Gleichgewicht.
Diese systemische Betrachtungsweise hat ihre Bedeutung auch in Arbeitszusammenhängen wie z.B. Firmen, Schulen oder Spitäler. Immer mehr Firmen lassen sich diesbezüglich beraten.
Rückführungen oder Regressionstherapie
80-90% unserer Handlungen vollziehen sich aufgrund von Informationen, die wir im Unterbewusstsein abgespeichert haben. Durch Rückführungen sind wir heute in der Lage, den Ursprung heutiger Konflikte oder uns störender Verhaltensweisen aufzudecken, die oftmals als Information durchgemachter schwerer Erfahrungen im Unterbewusstsein abgespeichert sind. Diese können wir dann auflösen, indem wir uns dieses Zusammenhangs bewusst werden.
Seit einigen Jahrzehnten existiert eine Technik, die wir Rückführung oder Reinkarnationstherapie nennen. Durch sie können wir einen Zugang zu unserem Unterbewusstsein erhalten.
Begonnen hat diese Arbeit in den 60er Jahren, als Psychologen und Psychotherapeuten feststellten, dass Bilder und Erfahrungen aus dem Unbewussten von Klienten ihren Ursprung auch in einer anderen Zeit haben können. Durch viele Forschungen und Rückführungssitzungen konnte bestätigt werden, dass es frühere Leben gibt und dass unsere Seele, gemachte Erfahrungen auch über mehrere Leben hinweg abzuspeichern.
Je nach Erfahrungen können diese sich als Postulate in unserem Unterbewusstsein festsetzen und unsere heutige Handlungsweise massiv beeinflussen.
Es ist wichtig zu wissen, dass weit mehr als 90% unseres Verhaltens durch Informationen, die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind, bedingt ist.
Wir können immer wieder erleben, dass wir in bestimmten Situationen in ähnlicher Weise reagieren, auch wenn völlig unterschiedliche Menschen zugegen sind. So nehmen wir wahr, dass wir z.B. in verschiedenen Partnerbeziehungen wiederholt in ähnlichen Situationen dieselben Konflikte erleben. Das zieht sich offenbar wie ein roter Faden durch unser Leben. Nur können wir uns oft keinerlei Grund oder Ursache erklären.
In einer Rückführungssitzung liegt oder sitzt der Klient. Nach einem Vorgespräch steigen wir mit einem bestimmten Thema ein und zu Anfang wird eine bestimmte Frage oder ein Satz formuliert. Der Klient hat ab jetzt die Augen geschlossen. Nun tauchen in der Regel Bilder auf und es zeigen sich Lebenssituationen, die der Klient sehr genau beschreiben kann. Auch ist er in der Lage, die Umgebung, die Kleidung und andere Merkmale zu schildern. Oftmals zeigt sich, dass er in einem anderen Leben angekommen ist und kann meist benennen, in welchem Land und zu welcher Zeit diese Bilder, die sich vor seinem inneren Auge zeigen, spielen. Der Klient ist bei vollem Bewusstsein und nicht in Hypnose.
In einer solchen Sitzung gelingt es, Zusammenhänge zu erkennen und aufzulösen, die sonst verborgen bleiben. Durch diese Arbeit wird deutlich, dass wir tiefgreifende Erfahrungen oder Traumata auch aus anderen Leben mit in dieses nehmen. Diese wirken heute in Form von Postulaten oder Glaubenssätzen weiter und bestimmen unser Handeln, ohne dass wir uns mit unserem heutigen Bewusstsein dieser Zusammenhänge bewusst werden.
Durch diese Methode wird uns deutlich, dass wir Erfahrungen in uns abspeichern und diese in uns weiter existieren, selbst über mehrere Leben hinweg. Wir können beispielsweise immer wieder erfahren, dass Kinder und Enkel von Menschen aus Kriegsgenerationen, deren schwere Erfahrungen auch in sich tragen, obwohl sie diese persönlich nie erlebt haben.
Dipl. Psych. Erika Schäfer, Therapie-, Lehr- und Forschungszentrum Eisenbuch, forscht seit vielen Jahren auf den Gebieten der familiensystemischen Aufstellungsarbeit und Reinkarnationstherapie. Ihre grandiose Leitung ist es, diese beiden Arbeitsweisen sehr fundiert zu lehren und anzuwenden und sie insbesondere miteinander zu kombinieren. Das bedeutet, dass der Therapeut während einer Aufstellung z.B. eine Rückführung durchführen kann. Erika Schäfer hat in ihrem Buch „Reinkarnationstherapie mit Kindern“ detailliert die Regressionstherapie auch unter historischen Aspekten beschrieben.
Dr. med. Michael J. Seefried
Ohne Sonne kein Leben – Aber wie viel Sonne/Leben brauchen wir?
Wenn wir in unser Weltensystem schauen, erkennen wir sofort, dass sich um die Sonne alles dreht. Damit meine ich, dass die Planeten inkl. der Erde sich um die Sonne drehen und um sich selbst. So entstehen für uns lebenswichtige Rhythmen: Jahreszeiten, Tag-Nacht-Rhythmus, auch der circadiane Rhythmus im Menschen ist vom Sonnenlicht abhängig.
Alles Leben ist von der Sonne abhängig und ohne sie nicht möglich. Seit einigen Jahren wird die Sonne auch als Risikofaktor diskutiert. Durch übermässige Sonneneinstrahlung kann Hautkrebs entstehen. Dieser nimmt in allen Industrienationen rasant zu, die Patienten werden immer jünger. Er ist z.B. bei Frauen zwischen 25 und 29 Jahren die häufigste Krebserkrankung!
Wie können wir uns einerseits vor dem Risiko Sonne schützen, andererseits aber die Sonne als Lebensquell geniessen? Ohne Sonne kann der Mensch einen schweren Vitamin D Mangel entwickeln und kleine Kinder sind besonders gefährdet (Entstehung der Rachitis). Auch hilft die Sonne den Menschen, ihren Seelenzustand zu stabilisieren, v.a. wenn sie zu Schwermütigkeit neigen.
Der schwarze Hautkrebs – das Melanom
Der gefährlichste und gefürchteste Hautkrebs ist das Melanom. Das Melanom entsteht aufgrund der Entartung von Melanozyten. Sie sind Pigmentzellen der Haut, die Melanin synthetisieren. Diese geben sie an die Keratinozyten, dem häufigsten Zelltyp ab. Das Melanin stellt einen wichtigen Schutz der Haut gegenüber UV-Strahlung dar. Unter UV-Einwirkung kommt es zur Aktivierung der Melanozyten (Hautbräunung). Diese bilden mit den umgebenden Keratinozyten die Melanozyteneinheit. Es ist nachgewiesen, dass das Entarten der Melanozyteneinheit, also die Entstehung des Hautkrebses mit der Kompetenz des Immunsystems korreliert. Je intakter und stabiler das Immunsystem, desto eher kann die Entstehung eines Hautkrebses verhindert werden. Das adäquate Durchmachen saisonaler Infekte oder die Fähigkeit Fieber zu entwickeln, kann Hinweise für die Funktionstüchtigkeit des Immunsystems geben. Sehr eindrücklich wird die Steigerung des Melanomrisikos durch Immunsuppressiva beobachtet. Die regelmässige Einnahme fiebersenkender Medikamente, Antibiotika oder der „Pille“ wurde noch nicht ausreichend untersucht. Dass diese Mittel eine immunschwächende Wirkung haben, ist bekannt.
Eine gute Stabilisierung der Melanozyteneinheit gelingt durch aktive Bewegung und eine wohl dosierte regelmässige Sonnenlichtaufnahme. Heute stehen wir jedoch in unserem Alltag vor einer zunehmenden Bewegungsarmut, einem langen Aufenthalt in Räumen mit künstlichem Licht und dann einer „schockartig“ einsetzenden Sonnenlichtexposition in der Freizeit. So gesehen können wir feststellen, dass wir die Entstehung eines Melanoms zum allergrössten Teil selbst in der Hand haben.
Ein paar Empfehlungen:
- Auch bei intensivem Arbeitsalltag, sollten wir in den Pausen nach draussen gehen,
- Stellen Sie ihren eigenen Hauttyp fest, denn Sonnenempfindlichkeit ist individuell und somit auch die Sonnenexposition,
- Sonnenangepasster Lebensrhythmus: Siesta einhalten (12-16 Uhr) v.a. in Südeuropa/Übersee und Kopfbedeckung tragen,
- Sonnenbrand verhindern, die Entstehung eines Hautkrebses korreliert mit der Häufigkeit von Sonnenbränden im Kindesalter; Kindern und Jugendliche sind besonders empfindlich, weil bei ihnen die Schutzmechanismen der Haut noch nicht vollständig entwickelt sind,
- Gibt es bereits Hautkrebs in der Familie? Dann ist ihr Risiko erhöht, ebenfalls einen Hautkrebs zu entwickeln (1-2 x pro Jahr Hautarzt konsultieren),
- Sonnencremes – fachkundige Beratung einholen in Apotheken, die einen komplementärmedizinischen Ansatz vertreten. Sonnencremes mit synthetischen UV-Filtern können allergische Reaktionen auslösen oder hormonelle (östrogene) Wirkungen haben,
- Sonnencremes verlocken zu einer exzessiven Sonnenlichtexposition. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass der Gebrauch von Sonnencremes die Häufigkeit von Melanomen senkt! In den Regionen, in denen das Melanom stark zugenommen hat, wird am meisten Sonnencreme verwendet.
Was könnte wesentlich in der Betrachtung der Sonne sein?
Rudolf Steiner in Anlehnung an das Johannes-Evangelium beschreibt: „…mit dem physischen Sonnenlicht strömt die warme Liebe der Gottheit auf die Erde; und die Menschen sind dazu da, die warme Liebe der Gottheit in sich aufzunehmen, zu entwickeln und zu erwidern. Das können sie nur dadurch, dass sie selbstbewusste Ich-Wesen werden. Nur dann können sie die Liebe erwidern“.
So können wir die Sonne als geistigen Quell verstehen, die uns Leben ermöglicht durch das Licht und die Wärme, die sie uns schenkt und letztendlich der Liebe als der allumfassenden Qualität und Kraft, die menschengemässes Leben erst ermöglicht. Nun könnten wir uns noch fragen, warum die Menschen in den Industrienationen so eine „Sonnen-Sehnsucht“ entwickelt haben – vielleicht weil sie durch die Kraft und Wärme der Sonne, den Verlust an sozialer Wärme und letztendlich zwischenmenschlicher Liebe zu kompensieren versuchen?
Dr. med. Michael J. Seefried
Gemeinschaften heute – eine Kulturtat?
Das Leben in einer Gemeinschaft ist ein grosses Bedürfnis des Menschen. Man könnte sagen, dass der Mensch in Gemeinschaft leben muss, weil er nicht dafür geschaffen ist, ganz für sich allein – beruflich und privat – zurecht zu kommen.
So lange die Menschheit existiert, existieren auch Gemeinschaften. Wir können sie als Grundelemente der Gesellschaft, als ursprünglichste Form des Zusammenlebens bezeichnen: Familien, Partnerschaften und Ehen, Sippen, Cliquen sowie „Clans“ sind Beispiele von Gemeinschaftsformen.
Gemeinschaft zeichnet ein emotionales Zusammengehörigkeitsgefühl, ein „Wir-Gefühl“, aus. Sie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ihre Mitglieder ein gemeinsames Ziel oder einen gemeinsamen Fokus haben. Doch nicht immer ist die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft freiwillig; es gibt auch sogenannte unfreiwillige Gemeinschaften.
Rasanter Wandel der Kommunikation und Mobilität
Heutzutage verspüren Menschen einen grossen Drang, sich frei entwickeln zu dürfen, unabhängig zu sein, sich von allen gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. In den letzten Jahrhunderten, vor allem seit der Industrialisierung, haben die Menschen eine enorme Entwicklung durchlaufen. Die rasende Technisierung im Mobilitäts- und Kommunikationssektor (Verkehrsmittel, Telegraphie, Telefon und Internet) sowie der Bewusstseinswandel haben das soziale Miteinander revolutioniert. Per SMS, Apps, Mails oder auch Telefonkonferenzen können wir uns mit mehreren Personen gleichzeitig austauschen. Wir merken aber, dass diese Art der Kommunikation aus qualitativer Sicht eine andere ist als die des persönlichen Gesprächs. Face-to-face gibt uns die Möglichkeit, die Kommunikation mit einer Stimmung aufzuladen bzw. die Mimik des Gegenübers und somit dessen Stimmung wahrzunehmen.
Die oben genannten Entwicklungen im Bereich der Mobilität und Kommunikation haben selbstverständlich auch auf die Ausgestaltung von Gemeinschaften einen bedeutenden Einfluss: Zum einen ermöglichen sie den Menschen, schneller miteinander in Kontakt zu kommen und Gemeinschaften zu bilden. Auf der anderen Seite haben schnell und spontan geschlossene Gemeinschaften häufig weniger Tiefe und bieten ihren Mitgliedern weniger Konstanz und Verlässlichkeit.
Wie und wo entsteht eine Gemeinschaft?
Anhand der folgenden Beispiele lässt sich exemplarisch betrachten, was es mit freiwilligen und unfreiwilligen Gemeinschaften auf sich hat und in welchen Situationen sie entstehen können:
Wenn heutzutage ein Paar heiratet, geht es freiwillig eine Lebensgemeinschaft ein. Keine Selbstverständlichkeit, denn in vorigen Jahrhunderten wurde die Frau – oftmals gegen ihren Willen – verheiratet. Und auch heute noch gibt es Kulturen, in denen diese Art der unfreiwilligen Gemeinschaft üblich ist.
Die Kinder, die aus einer Ehe entstehen, gehören dieser Gemeinschaft an. Ob Kinder freiwillig oder unfreiwillig Mitglieder dieser Gemeinschaft werden, ist eine Sache der persönlichen Betrachtungsweise und wird durchaus unterschiedlich beurteilt. Ich persönlich meine, dass Kinder sich ihre Eltern aussuchen, das also eine gewisse Freiwilligkeit von Seiten der Kinder besteht. Ein schicksalhafter Weg ist jedoch niemals fest vorgeschrieben und es bleibt immer in der Verantwortung der Eltern, eine Familie als Gemeinschaft oder eine Trennung bestmöglich zu gestalten.
Wann ist eine Gemeinschaft wirklich als solche zu bezeichnen? Ein Beispiel: Wenn wir mit 200 anderen Menschen in ein anderes Land fliegen, sind wir – aus meiner Sicht – noch keine Gemeinschaft. Wir haben zwar alle das gleiche Ziel und benutzen zur gleichen Zeit das gleiche Verkehrsmittel; doch von einem „Wir-Gefühl“ kann da nicht die Rede sein. Wird aber das Flugzeug entführt, verwandelt sich diese Gruppe in eine Schicksalsgemeinschaft.
Beispiel Schule: dort können wir sehr viele Gemeinschaften entdecken, die eine grosse Kontinuität und Stabilität haben, da sie über lange Zeiträume hinweg wachsen und Bestand haben: Lehrer- und Klassengemeinschaften, Elterngemeinschaften (sowohl der Schule als auch in den einzelnen Klassen) sowie verschiedene Gremien wie die Schulleitung, Unterstufen- und Oberstufen-Konferenz und die Personalgruppe.
Gemeinschaften unter dem Aspekt des Bewusstseinswandels
Wenn wir uns die Evolution der Menschheit unter dem Gesichtspunkt der mitmenschlichen Begegnung und dem Gestalten von Gemeinschaften anschauen, so erkennen wir, dass die Menschheit eine Bewusstseinsentwicklung durchläuft.
Ungeschriebene Gesetze der Gesellschaft bzw. des Stammes oder der Familie zwangen das Individuum, ein vorgegebenes Verhalten einzuhalten. Die zu früheren Zeiten selbstverständliche und nicht hinterfragte Blutsbande funktioniert so nicht mehr: Heute streben wir an, möglichst alle Gemeinschaften bewusst und freiwillig zu bilden und zu gestalten. Dies ist jedoch immer schwieriger zu bewältigen. Denn die erlangte Freiheit und das Bedürfnis nach Individualisierung sind für viele von uns noch sehr neu, so dass sie keine selbstverständlichen Elemente unserer Persönlichkeit geworden sind. Aus diesem Grunde ist der Anteil der Single-Haushalte, der geschiedenen Ehen und der Patchworkfamilien noch nie so hoch gewesen wie jetzt.
Die Partnerschaft als Gemeinschaft
Ein schier endloses Feld ist die Partnerschaft unter dem Gesichtspunkt der Gemeinschaft: Unzählige Autoren haben bereits über die Unterschiede zwischen Mann und Frau gesprochen und philosophiert. Aus meiner Sicht gilt vor allem der Aspekt zu berücksichtigen, dass das Wesensgliedergefüge bei einer Frau anders ist als beim Mann. Sie verfügt über einen anderen Äther- oder Astralleib. Körperbau, Muskel- und Fettverteilung, Stoffwechsel- und hormonelle Vorgänge sowie Rhythmen und vieles Mehr funktionieren bei Mann und Frau unterschiedlich, ebenso wie das Denken und Fühlen. Doch es gibt auch durchaus Überschneidungen zwischen den beiden Geschlechtern: Rudolf Steiner und andere sprechen von „anima und animus“: Jeder Mann trägt einen weiblichen Teil in sich, jede Frau einen männlichen.
Beobachte oder befrage ich Paare, die eine gute Partnerschaft leben, so stelle ich fest, dass sie sich Achtung und eine gewisse Ehrfurcht voreinander bewahrt haben. Diese kommt zum vertrauensvollen Tragen, wenn sich Konflikte anbahnen, die zu einer Eskalation führen könnten. Je mehr wir diese Qualitäten in uns selber leben, desto mehr kann eine Partnerschaft gelingen, in der diese beiden Qualitäten als tragende Säulen leben.
Gemeinschaft Familie
Bekommt ein Paar ein Kind, werden aus einer Gemeinschaft zwei Gemeinschaften: die Familie und die Eltern. Dies ist eine wichtige, grundlegende Tatsache, die im Familienalltag gerne vergessen wird. Die Eltern bleiben als Paar eine Gemeinschaft. Nun gilt es also, zwei Gemeinschaften zu pflegen. Je mehr die Eltern ihre Partnerschaft als Gemeinschaft pflegen und gestalten, um so mehr kann die Familie als Gemeinschaft gelingen. Zudem sind dann die Eltern – neben ihren erzieherischen Aufgaben – ein gutes Vorbild.
Knapp die Hälfte aller Familien wird durch eine Trennung auseinander gerissen, die Tendenz ist steigend. Befragt man zehn oder zwanzig Jahre nach einer Trennung diese Menschen erneut, zeigen sich häufig zwei Dinge:
- ein bedeutender Anteil würde diese Trennung heute nicht noch einmal durchführen und
- die Trennung wurde als einschneidendes und in der Regel traumatisierendes Erlebnis für ihre Kinder unterschätzt.
Auch wenn es die Blutsbande heutzutage nicht mehr gibt, sehen wir doch, dass es für alle Angehörigen der Gemeinschaft „Familie“ ein sehr einschneidendes Erlebnis ist, wenn die Familienbande zerstört wird. Das bedeutet, so freiheitlich, individuell und „eigenverantwortlich“ wir auch handeln und den Anspruch haben, in einer solchen Welt zu leben, so abhängig sind und bleiben wir natürlichen Gesetzmässigkeiten gegenüber. Diese heissen in einer Familie: der Vater ist und bleibt der Vater, die Mutter die Mutter, das erstgeborene Kind das Erstgeborene etc. Die gebildete Gemeinschaft als Familienbande kann durch eine Trennung der Eltern nicht einfach aufgelöst werden: Sie verändert sich, weil der Alltag in anderer Weise organisiert und gelebt wird. Grundsätzlich jedoch bleibt sie bestehen. Mit „eigenverantwortlich“ meine ich in diesem Zusammenhang auch: Ein Partner löst in der Regel eine Partnerschaft auf, um das Wohlbefinden aller zu retten, zu verbessern oder aber weil er die festgefahrene Situation nicht mehr aushält. Dabei ist es dann möglich, dass die Aufmerksamkeit um die anderen Familienmitglieder leicht verloren geht.
Erhalt der Familiengemeinschaft trotz Trennung
Eine der wichtigsten Aufgaben für Eltern mit Trennungsabsicht ist es, die Familienbande möglichst zu erhalten. Dies kann aus meiner Sicht gelingen, wenn man folgende Grundsätze beachtet: Getrennt werden kann nur die Paarbeziehung. Die Eltern bleiben die Eltern und sie sollten beide aus familiensystemischer Sicht ihre Rechte und Pflichten als Eltern vollständig behalten. Ein „meisterhafter Kunstgriff“ der Eltern wäre, die Trennung von der Erziehungsaufgabe vollständig loszulösen. Denn das Beste für die Kinder ist es, trotz Trennung möglichst eine Familiengemeinschaft zu erhalten. Persönliches und insbesondere Schmerzvolles, das zur Trennung geführt hat, sollten die Eltern nach Möglichkeit für das Wohl der Kinder zurückstellen. Das schliesst nicht aus, dass die Eltern keine neue Partnerschaft eingehen können. Der Fokus auf das Wohl der Kinder sollte allerdings möglichst von den leiblichen Eltern getragen werden. Denn die Kinder haben Vater und Mutter in sich und sollten spüren können, dass es noch eine Achtung zwischen den Eltern gibt.
Leider zeigt der Alltag häufig eine andere Vorgehensweise. Diese ist geprägt von Verletzungen und Schuldzuweisungen, die sich die Eltern gegenseitig zufügen. Sensible Kinder merken, wenn die Mutter den Vater vehement ablehnt und sehr verletzt ist, weil sie dadurch den väterlichen Anteil im Kind ablehnt. Umgekehrt gilt dies genauso. Mit Schuldzuweisungen jedoch kann keine friedliche Lösung gelingen. Und allzu oft laden die Kinder Schuld unbewusst auf sich, um ihre Eltern zu entlasten, zu denen sie eine tiefe Loyalität und Liebe empfinden.
Wenn mich Eltern um Mithilfe in einer Trennungssituation bitten, so ist es erforderlich, dass Vater und Mutter einwilligen, sich mit mir an einen Tisch zu setzen. Gemeinsam kann man dann über die bestmöglichen Lösungen für sie und für die Kinder beraten. Gelingt dieser entscheidende Schritt, gelingt in den meisten Fällen eine lebbare Lösung für alle. Und: Die Familiengemeinschaft kann gewahrt bleiben!
Die Kulturepoche löst das Zeitalter der Polaritäten ab
Heute in unserer “bewusstseinsreichen“ Zeit, die einerseits durch den Drang nach Individualismus, Freiheit und Selbstverwirklichung geprägt ist, zeigt sich andererseits eine immer stärkere Vereinsamung des Einzelnen. Zudem leben wir in einer Phase, in der ein Zeitalter zu Ende geht und zugleich ein neues beginnt. Das Zeitalter der Polaritäten (Gut & Böse), der Religionen, der Sympathie & Antipathie, des Egoismus & des Materialismus neigt sich dem Ende zu. Es macht einer Kulturepoche Platz, die den Materialismus als existenzielle Grösse überwindet und die Polaritäten ausgleicht. Die Folge: Zwischen Egoismus und Selbstlosigkeit kann ein Gleichgewicht entstehen und auch die Wahrnehmungsfähigkeit sowie die Kommunikationsformen der Menschen verändern sich.
Die Medienentwicklung birgt in sich die Gefahr, dass sich ein inhaltlicher Austausch zwischen Menschen etabliert, der den Namen „Kommunikation“ – also Mitteilung bzw. Austausch von Ideen, Phantasien, Stimmungen – nicht mehr verdient. Grundlegende Elemente menschlichen Seins wie das Gespräch können verrohen. Unsere Aufgabe ist es, dies zu erkennen und der Zeit gemäss, wie hier beschrieben, gegenzusteuern. Es gibt immer mehr Initiativen, die diese gefährliche Entwicklung erkennen.
Sucherseelen – eine neue Generation von Kindern mit feiner Wahrnehmung
Wir erleben heute, dass immer mehr Kinder als „neue Seelen“ oder Indigo-Kinder eine andere feinere Wahrnehmung mitbringen und die Welt offenbar durch andere Augen sehen als wir es gewohnt sind. Sehr treffend werden diese Kinder auch als „Sucherseelen“ bezeichnet. Solche Kinder sind oft hypersensibel, haben eine sehr gute Intuition für Stimmungen sowie ein gutes Selbstwertgefühl. Oftmals haben sie es schwer, sich anzupassen, können auch rebellisch oder gar aggressiv sein.
Diese „neue“ Kindergeneration wird seit den 80er Jahren beschrieben. Sie stellt uns vor enorme Herausforderungen, weil diese Kinder teilweise nicht mehr in unsere gesellschaftlichen Normen passen. Hier sind die Fachleute aufgerufen, zu unterscheiden, wo solche Kinder eine besondere Form der Begleitung bedürfen oder ob sie für einen bestimmten Bereich eine gezielte Hilfe benötigen, weil sie dort eine therapiebedürftige Abweichung vorweisen. Diese Entwicklung impliziert darüber hinaus grundsätzliche Gedanken, wie eine Schule zukünftig strukturiert sein sollte.
Die Gemeinschaft als Kulturtat meistern
Ob als Partnerschaft oder in einem anderen Zusammenhang – eine Gemeinschaft zu bilden, zu pflegen und zu erhalten, ist beachtenswerte Leistung aller Beteiligten. Denn gelernt haben wir das nicht. Unsere Eltern und Grosseltern sind uns in diesem Punkt kein Vorbild, weil zu ihrer Zeit Gemeinschaften anders gelebt wurden, als es heute erforderlich ist. Zudem gestalten wir unser Dasein an einem Scheidepunkt zwischen „alter“ und „neuer“ Kulturepoche. Dies bringt in unserem Sein immense Veränderungen mit sich, die sich in vielen Lebensbereichen auswirken werden – vor allem in der Frage, wie uns in Zukunft das soziale Miteinander und die Bildung von Gemeinschaften gelingen werden.
Wenn wir Qualitäten wie Achtung und Ehrfurcht im Alltag leben können, wenn wir neugierig auf das blicken, was durch die neue Kulturepoche an uns herangetragen wird, und wenn wir diese Veränderungen in unser Leben integrieren können, dann werden wir die Herausforderung „Gemeinschaft als Kulturtat“ meistern. Davon bin ich überzeugt!
Dr. med. Michael J. Seefried

